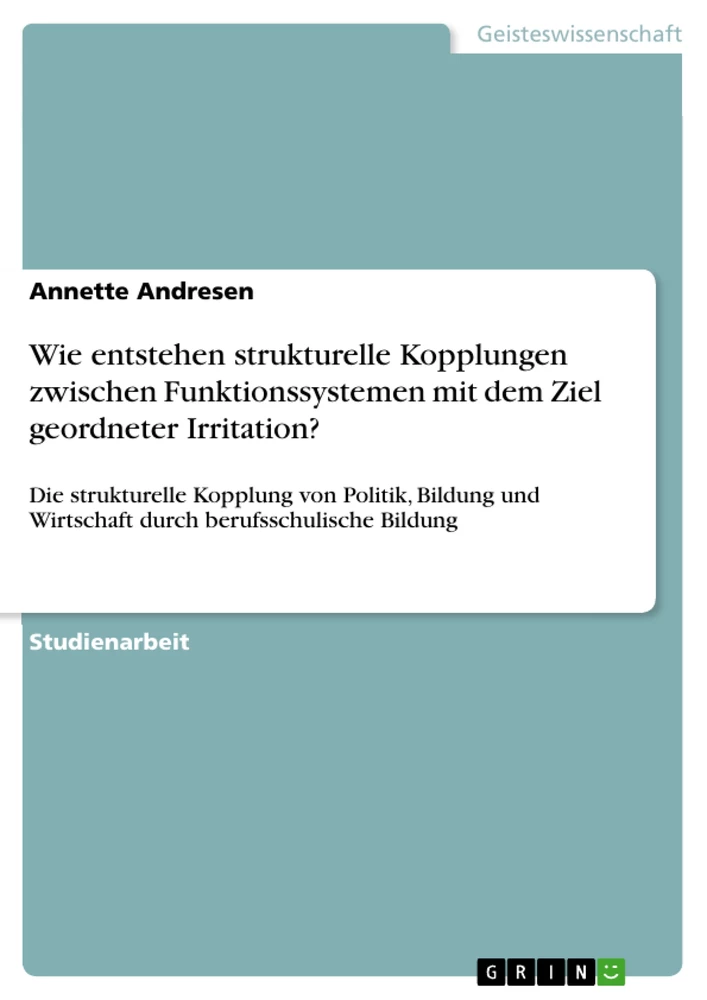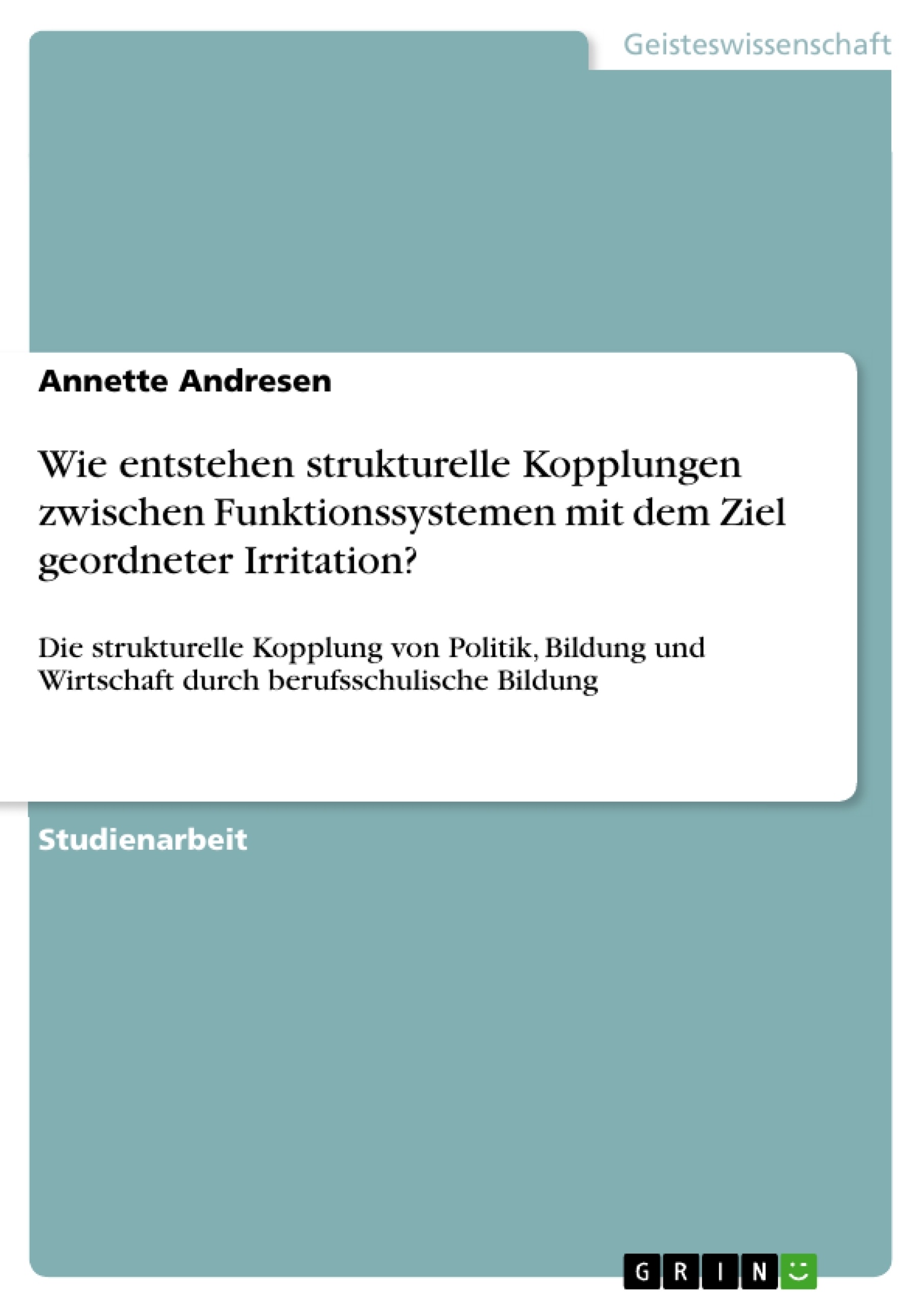Luhmanns Systemtheorie mag für viele ein abstraktes und theoretisches Konstrukt sein – sie ist jedoch aus soziologischer Perspektive auf viele aktuelle Themen anwendbar und kann dort ihre bestechend klare Analyse bestehender sozialer Tatsachen zeigen. Die Präferenz Luhmanns für die enthumanisierte Seite der Form System/Umwelt, die als System bezeichnet wird, mag befremdlich wirken, ist aber nach Luhmann logisch, wenn das soziale System in seiner Emergenz als eine eigene Realitätsebene betrachtet wird, als eine Soziologie als Wissenschaft der Sozialität. Mit Luhmann ist folglich eine werturteilsfreie, soziologisch-analytische Betrachtung sozialer Tatsachen möglich – und dieser klare Blick soll in dieser Arbeit als verständnisfördernd auf das "Funktionsgemenge" der berufsschulischen Bildung dienen.
Mit dem Blick auf den Terminus der ‚strukturellen Kopplung‘ als Instrument der Erfassung des Verhältnisses verschiedener Funktionsbereiche sollen in dieser Hausarbeit die Kommunikationsmöglichkeiten der sozialen Teilbereiche der Politik, Bildung und Wirtschaft betrachtet werden. Dies wird illustriert am Beispiel der berufsschulischen Bildung in Schleswig-Holstein, welche seit 2021 von der Politik dem Bildungsministerium entzogen und dem Wirtschaftsministerium zugeordnet wurde. Dafür wird in dieser Hausarbeit nur die deutsche berufsschulische
Bildung betrachtet. Durch ihre Ausdifferenzierung, die weltweit fast einmalige Duale Ausbildung und ihre historisch Mischform aus Politik-Bildung-Wirtschaft wird sie als höchst erkenntnisreich für eine Betrachtung aus Luhmanns systemtheoretische Perspektive unter dem Aspekt der strukturellen Kopplung gesehen.
In Kapitel 2 werden inhaltlich einleitend kurz allgemeine Charakteristika der Systemtheorie Luhmanns umrissen und in den Unterkapiteln 2.1 und 2.2 weiter auf die hier fokussierten selbstreferentiellen Systeme und deren Kommunikationsmöglichkeiten verengt. In Kapitel 3 werden die drei betrachteten Funktionssysteme Politik, Bildung und Wirtschaft sowie deren Spezifika und bestehender struktureller Kopplungen beschrieben. In Kapitel 4 wird das gewählte Beispiel Schleswig-Holstein beschrieben und systemtheoretisch analysiert, und in Kapitel 5 wird das Fazit dieser Ausarbeitung gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Luhmanns Systemtheorie – ein kurzer Überblick
- Typen sozialer Systeme, Funktionssysteme und Autopoiesis
- Kommunikation, strukturelle Kopplung, Irritation und Codes
- Die Funktionssysteme Politik, Bildung und Wirtschaft
- Spezifika und Codes
- Bestehende strukturelle Kopplungen in historischer Begründung und die Entwicklung des Berufsbildungssystems
- Der politische Sonderweg in Schleswig-Holstein
- Systemtheoretische Betrachtung des Beispiels
- Chancen und Risiken dieses Sonderwegs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung struktureller Kopplungen zwischen Funktionssystemen, insbesondere im Kontext geordneter Irritationen. Sie analysiert die Interaktionen zwischen Politik, Bildung und Wirtschaft am Beispiel der berufsschulischen Bildung in Schleswig-Holstein, unter Anwendung der Systemtheorie Niklas Luhmanns. Der Fokus liegt auf der Beschreibung und Analyse der Kommunikationsmöglichkeiten zwischen diesen Systemen und den Folgen der strukturellen Kopplung.
- Anwendung der Systemtheorie Luhmanns auf die Analyse sozialer Systeme
- Strukturelle Kopplung zwischen Politik, Bildung und Wirtschaft
- Das Berufsbildungssystem in Schleswig-Holstein als Fallbeispiel
- Analyse der spezifischen Codes und Kommunikationsmöglichkeiten der beteiligten Funktionssysteme
- Bewertung der Chancen und Risiken der beobachteten strukturellen Kopplung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die strukturelle Kopplung von Politik, Bildung und Wirtschaft durch das Beispiel der berufsschulischen Bildung in Schleswig-Holstein, insbesondere die Verlagerung der Zuständigkeit vom Bildungs- zum Wirtschaftsministerium im Jahr 2021. Sie nutzt Luhmanns Systemtheorie als analytisches Werkzeug, um die Kommunikationsprozesse und die Folgen dieser Kopplung zu verstehen. Der Fokus liegt auf der deutschen berufsschulischen Bildung und ihrer besonderen, historisch gewachsenen Mischform aus Politik, Bildung und Wirtschaft.
Luhmanns Systemtheorie – ein kurzer Überblick: Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in die zentralen Konzepte der Systemtheorie Luhmanns. Im Gegensatz zu Parsons' struktural-funktionalem Ansatz, der normative Aspekte betont, priorisiert Luhmann die Funktion über die Struktur und analysiert die Anpassungsfähigkeit von Systemen an Veränderungen. Der Schlüsselbegriff der System-Umwelt-Differenz und die Selbstreferentialität von Systemen werden erläutert, um den theoretischen Rahmen für die weitere Analyse zu legen. Der Fokus liegt auf selbstreferentiellen Systemen und deren Kommunikationsmöglichkeiten.
Die Funktionssysteme Politik, Bildung und Wirtschaft: Dieses Kapitel beschreibt die drei relevanten Funktionssysteme – Politik, Bildung und Wirtschaft – mit ihren spezifischen Codes und bereits bestehenden strukturellen Kopplungen. Es legt die Grundlagen für das Verständnis der Interaktionen zwischen diesen Systemen im Kontext des Berufsbildungssystems. Die historische Entwicklung und die bestehenden Kopplungen werden beleuchtet.
Der politische Sonderweg in Schleswig-Holstein: Dieses Kapitel analysiert den Fall Schleswig-Holstein und die systemtheoretischen Implikationen der Verlagerung der Zuständigkeit für berufsschulische Bildung vom Bildungs- zum Wirtschaftsministerium. Es untersucht die Chancen und Risiken dieser politischen Entscheidung im Kontext der strukturellen Kopplung der drei Funktionssysteme. Die systemtheoretische Betrachtung des Beispiels bildet den Kern dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Strukturelle Kopplung, Niklas Luhmann, Systemtheorie, Funktionssysteme, Politik, Bildung, Wirtschaft, Berufsbildungssystem, Schleswig-Holstein, Kommunikation, Selbstreferentialität, Codes, geordnete Irritationen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Strukturelle Kopplung im Berufsbildungssystem Schleswig-Holsteins
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die strukturelle Kopplung zwischen den Funktionssystemen Politik, Bildung und Wirtschaft am Beispiel der berufsschulischen Bildung in Schleswig-Holstein. Der Fokus liegt auf der Analyse der Kommunikationsprozesse und der Folgen dieser Kopplung, insbesondere im Hinblick auf die Verlagerung der Zuständigkeit für berufsschulische Bildung vom Bildungs- zum Wirtschaftsministerium im Jahr 2021.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die Systemtheorie von Niklas Luhmann als analytisches Werkzeug. Sie konzentriert sich auf zentrale Konzepte wie Selbstreferentialität, Kommunikation, strukturelle Kopplung, Codes und geordnete Irritationen, um die Interaktionen zwischen den betrachteten Funktionssystemen zu verstehen.
Welche Funktionssysteme werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die drei Funktionssysteme Politik, Bildung und Wirtschaft. Die Arbeit beschreibt deren spezifische Codes und bereits bestehenden strukturellen Kopplungen, um die Interaktionen im Kontext des Berufsbildungssystems zu beleuchten.
Was ist das konkrete Fallbeispiel?
Das konkrete Fallbeispiel ist die berufsschulische Bildung in Schleswig-Holstein und der „politische Sonderweg“ der Verlagerung der Zuständigkeit für die berufliche Bildung vom Bildungs- zum Wirtschaftsministerium. Die Arbeit analysiert die systemtheoretischen Implikationen dieser Entscheidung.
Welche Aspekte werden im Einzelnen untersucht?
Die Arbeit untersucht die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den drei Funktionssystemen, die Folgen der strukturellen Kopplung, die Chancen und Risiken des politischen Sonderwegs in Schleswig-Holstein und die historische Entwicklung der Kopplungen im Berufsbildungssystem.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Luhmanns Systemtheorie, ein Kapitel zu den Funktionssystemen Politik, Bildung und Wirtschaft, ein Kapitel zum politischen Sonderweg in Schleswig-Holstein und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, Angaben zur Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Strukturelle Kopplung, Niklas Luhmann, Systemtheorie, Funktionssysteme, Politik, Bildung, Wirtschaft, Berufsbildungssystem, Schleswig-Holstein, Kommunikation, Selbstreferentialität, Codes, geordnete Irritationen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung struktureller Kopplungen zwischen Funktionssystemen im Kontext geordneter Irritationen zu untersuchen und die Interaktionen zwischen Politik, Bildung und Wirtschaft am Beispiel der berufsschulischen Bildung in Schleswig-Holstein zu analysieren. Die Anwendung der Systemtheorie Luhmanns steht dabei im Vordergrund.
- Quote paper
- Annette Andresen (Author), 2022, Wie entstehen strukturelle Kopplungen zwischen Funktionssystemen mit dem Ziel geordneter Irritation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1252946