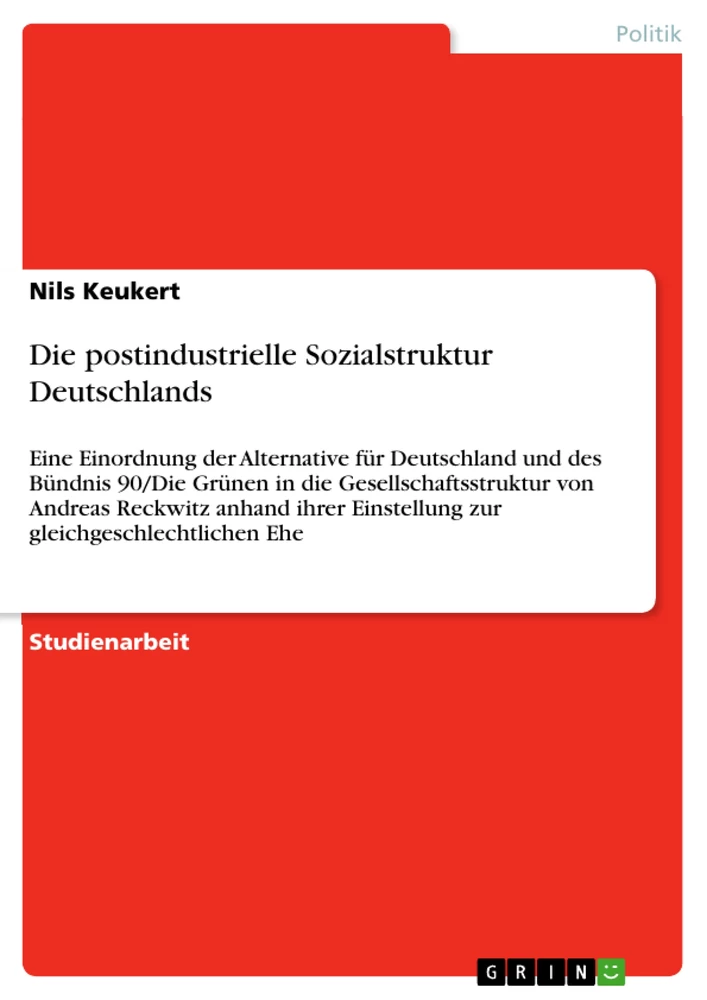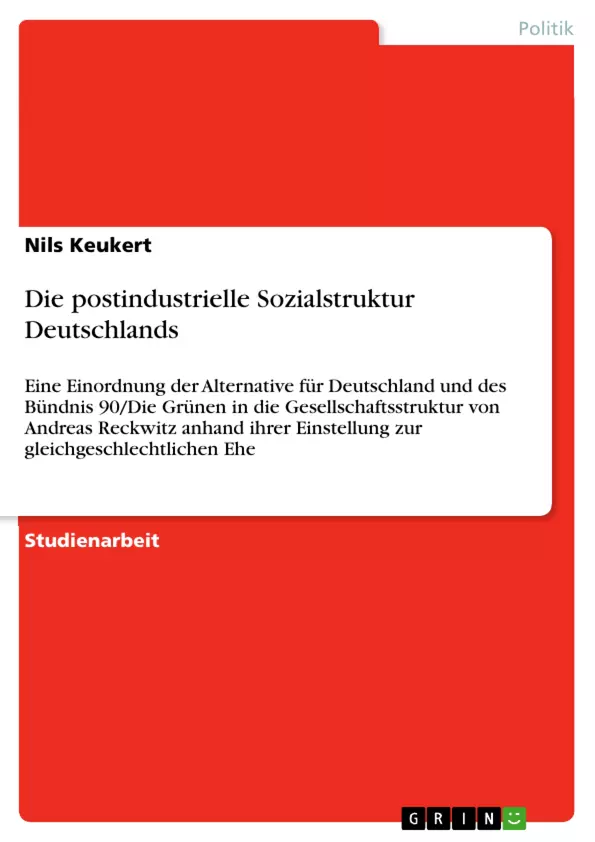Inwieweit lassen sich rechtspopulistische und links-liberale Parteien in Reckwitz‘ Gesellschaftsmodell einordnen? Lassen sich Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen den Parteien finden? Ergeben sich Muster in der Argumentation? Dies soll anhand der Einstellung deutscher Parteien zur gleichgeschlechtlichen Ehe untersucht werden. Hierbei eignet sich Deutschland, da es erstens mit seinem Mehrparteiensystem eine reichhaltige Auswahl an Parteien aus dem rechten wie linken politischen Spektrum bietet. Zweitens ist die Thematik der gleichgeschlechtlichen Ehe im Gegensatz zu anderen Ländern verhältnismäßig neu. Als Partei der alten Mittelschicht wird die AfD in die Untersuchung einbezogen.
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Zuerst wird der begriffliche Rahmen erläutert. Hierbei wird sich insbesondere auf die für die Forschungsfrage relevanten Klassen der alten und neuen Mittelklasse konzentriert. Anschließend wird im empirischen Teil ausführlicher auf die Methodik eingegangen und die Parteien hinsichtlich ihrer Haltung zur gleichgeschlechtlichen in das Gesellschaftsmodell von Reckwitz eingeordnet. Es wird erwartet, dass sich die AfD als Vertreter der alten Mittelklasse gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ausspricht, die Grünen hingegen als Vertreter der neuen Mittelklasse diese befürworten. Abschließend werden die Ergebnisse resümiert und ein kurzer Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der theoretische Rahmen: Von der nivellierten Mittelschicht der Nachkriegszeit zur 3+1-Struktur des 21. Jahrhunderts.
- 3. Die Verortung der Alternativen für Deutschland und des Bündnis 90/Die Grünen in Reckwitz' Klassenmodell anhand ihrer Einstellung zur gleichgeschlechtlichen Ehe
- 4. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Positionierung der AfD und der Grünen in der deutschen Gesellschaft anhand ihrer Einstellung zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Sie untersucht, ob sich diese Parteien, basierend auf Andreas Reckwitz' Modell der 3+1-Gesellschaft, in die alte und neue Mittelklasse einordnen lassen.
- Die Entwicklung der deutschen Gesellschaft von einer nivellierten Mittelklasse zu einer ausdifferenzierten 3+1-Gesellschaft.
- Die Einordnung der AfD und der Grünen in Reckwitz' Klassenmodell.
- Die Rolle der gleichgeschlechtlichen Ehe als Indikator für die Positionierung der Parteien.
- Die Analyse von Argumentationsmustern und Unterschiede zwischen den Parteien.
- Die Bedeutung der gleichgeschlechtlichen Ehe in der gesellschaftlichen Debatte.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz des Rechtspopulismus und die Bedeutung von links-grünen Parteien im aktuellen gesellschaftlichen Kontext dar. Sie führt das Konzept der 3+1-Gesellschaft von Andreas Reckwitz ein und erläutert die Notwendigkeit, die Positionierung von Parteien in diesem Modell zu untersuchen.
- Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der deutschen Gesellschaft vom Nachkriegszeitraum bis zur heutigen 3+1-Gesellschaft. Es analysiert die Einflussfaktoren wie Postindustrialisierung, Bildungsexpansion und Wertewandel, die zu dieser Entwicklung geführt haben.
- Kapitel 3 untersucht die Positionierung der AfD und der Grünen im Klassenmodell von Reckwitz. Es analysiert die Einstellung beider Parteien zur gleichgeschlechtlichen Ehe, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Argumentationsmustern aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Rechtspopulismus, AfD, Bündnis 90/Die Grünen, 3+1-Gesellschaft, Andreas Reckwitz, gleichgeschlechtliche Ehe, Postindustrialisierung, Bildungsexpansion, Wertewandel, Klassenmodell, politische Positionierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 3+1-Gesellschaftsmodell von Andreas Reckwitz?
Es beschreibt die moderne Sozialstruktur Deutschlands, die sich von einer nivellierten Mittelklasse zu einer Struktur aus neuer Mittelklasse, alter Mittelklasse, prekärer Unterklasse und einer Elite entwickelt hat.
Wie wird die AfD in diesem Gesellschaftsmodell eingeordnet?
Die AfD wird in der Untersuchung als Vertreterin der „alten Mittelschicht“ betrachtet, die häufig traditionelle Werte verteidigt und dem gesellschaftlichen Wertewandel skeptisch gegenübersteht.
Welche Position vertreten die Grünen laut Reckwitz?
Die Grünen gelten als klassische Vertreter der „neuen Mittelklasse“, die durch hohe Bildung und postmaterielle, links-liberale Werte geprägt ist.
Warum dient die gleichgeschlechtliche Ehe als Indikator in dieser Arbeit?
Die Haltung zur gleichgeschlechtlichen Ehe verdeutlicht die tiefen kulturellen Unterschiede und Argumentationsmuster zwischen der alten und der neuen Mittelklasse sowie deren politischen Repräsentanten.
Welche Faktoren führten zum Wandel der deutschen Sozialstruktur?
Wesentliche Treiber waren die Postindustrialisierung, die Bildungsexpansion seit den 1970er Jahren sowie ein grundlegender gesellschaftlicher Wertewandel.
- Quote paper
- Bachelor Nils Keukert (Author), 2022, Die postindustrielle Sozialstruktur Deutschlands, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1249790