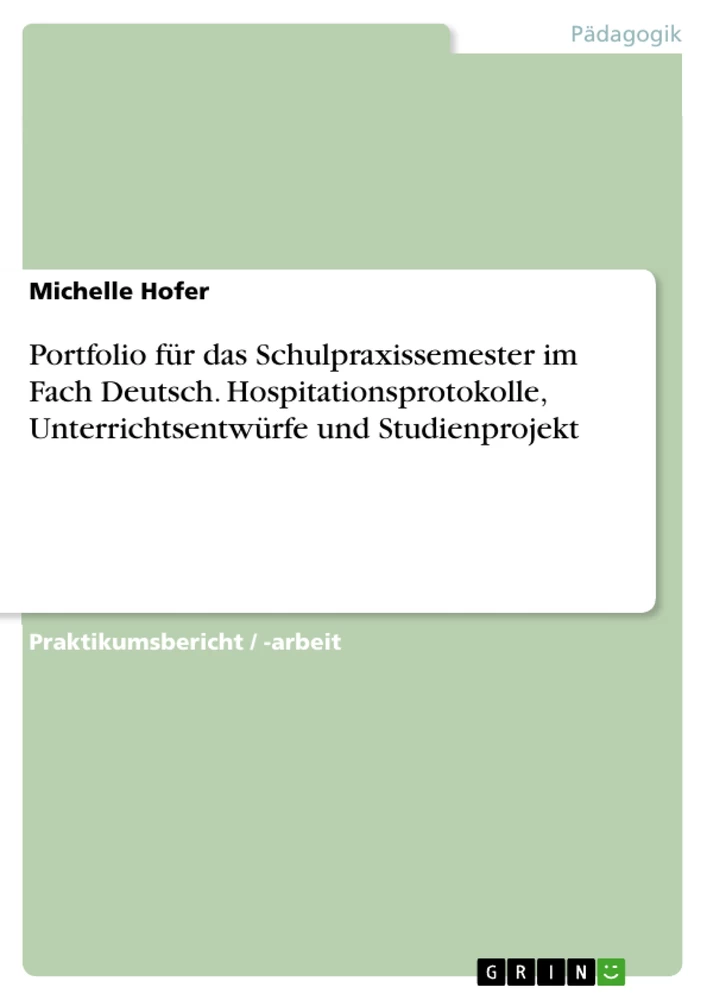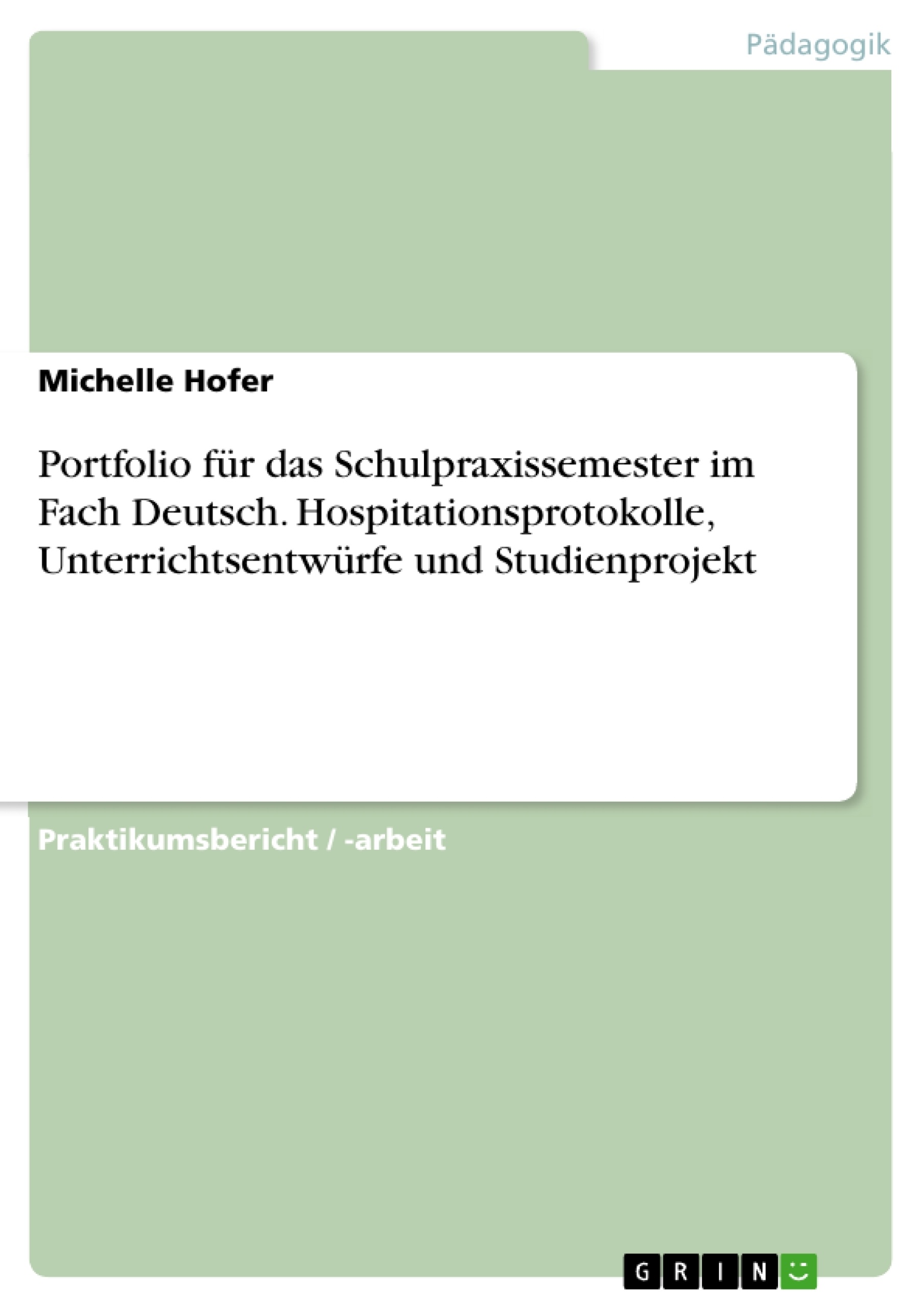In diesem Portfolio werden zwei Unterrichtsentwürfe für das Fach Deutsch vorgestellt. Einmal zu "Faust" und einmal zu "Märchen aus aller Welt". Des weiteren werden Hospitationsprotokolle und ein Studienprojekt erläutert und Erfahrungen mit einer Schulklasse aus dem Praxissemester geteilt.
Inhaltsverzeichnis
- Hospitationsprotokolle und Auswertung
- Reflexion Unterrichtsprotokoll
- Reflexion Lernerbedingungsanalyse
- Unterrichtsentwurf 1: Faust
- Einordnung der Stunde in die längerfristige Planung
- Einordnung der Stunde in die Unterrichtssequenz
- Konzeption der Sequenz
- Planungstabelle der Sequenz „Drama und Kommunikation: Goethes Faust als epochenübergreifendes Werk
- Bedingungsanalyse
- Institutionelle Voraussetzungen der Schule
- Zusammensetzung und Besonderheiten der Lerngruppe
- Didaktische Analyse
- Sachanalyse
- Lernziele
- Richtziel
- Grobziel
- Feinziele
- Begründung der Unterrichtsstruktur
- Tabellarische Übersicht der Lerneinheit
- Didaktische Reflexion
- Einordnung der Stunde in die längerfristige Planung
- Unterrichtsentwurf II: „Märchen aus aller Welt“
- Einordnung der Stunde in die längerfristige Planung
- Einordnung der Stunde in die Unterrichtssequenz
- Lehrplanbezug und fachdidaktische Verortung
- Konzeption der Sequenz
- Planungstabelle der Sequenz „Es war einmal: Märchen untersuchen und schreiben“
- Bedingungsanalyse
- Institutionelle Voraussetzungen der Schule
- Zusammensetzung und Besonderheiten der Lerngruppe
- Sachanalyse
- Märchen
- Märchen aus aller Welt
- ,,Das Geschenk der Löwin\"-Ein Märchen aus Afghanistan
- Didaktische Analyse
- Lernziele
- Richtziel
- Grobziel
- Feinziele
- Begründung der Unterrichtsstruktur
- Tabellarische Übersicht der Lerneinheit
- Didaktische Reflexion
- Lernziele
- Einordnung der Stunde in die längerfristige Planung
- Studienprojekt: Differenzierung im Deutschunterricht zum Thema Flektierbare Wortarten
- Differenzierung
- Definition
- Ziele der Differenzierung
- Gelingensbedingungen individualisierender und differenzierender Maßnahmen
- Binnendifferenzierung
- Die Grenzen und Umsetzungsschwierigkeiten der Binnendifferenzierung
- Die Lerntheke als Möglichkeit zur Inneren Differenzierung
- Definition
- Durchführung
- Möglichkeiten zur individuellen Förderung
- Planung und Durchführung der Lerntheke in der Unterrichtssequenz „Im Land der Wortarten“
- Einordnung der Stunde in die längerfristige Planung
- Bedingungsanalyse
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Methodenanalyse Lerntheke
- Lernziele
- Begründung der Unterrichtsstruktur
- Tabellarische Übersicht der Lerneinheit
- Didaktische Reflexion
- Differenzierung
- Lern- und Entwicklungsprozess
- Portrait Praktikumsschule
- Theoretische Darstellung
- Schulprofil
- Reflexion
- Fachlehrplan Deutsch
- Beschreibung anderer Aktivitäten in der Schule
- Zukunftstag (Girls' Day, Boys' Day) (5. bis 8. Klasse)
- ,,Verrückt? Na und!“
- Reflexion des Schulpraxissemesters
- Erwartungen und Ziele an das Praktikum
- Persönliche Entwicklung während des Praktikums
- Portrait Praktikumsschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit stellt ein Portfolio zum Schulpraxissemester im Fach Deutsch dar. Es werden verschiedene Unterrichtsentwürfe, die durch Hospitationen und Analysen entstanden sind, reflektiert und analysiert.
- Die Planung und Durchführung von Unterrichtseinheiten im Fach Deutsch
- Die Analyse und Reflexion der Unterrichtserfahrungen
- Die Auseinandersetzung mit verschiedenen didaktischen Ansätzen und Methoden
- Die Entwicklung von Kompetenzorientiertem Unterricht
- Die Reflexion des eigenen Lern- und Entwicklungsprozesses während des Schulpraxissemesters
Zusammenfassung der Kapitel
- Hospitationsprotokolle und Auswertung: Dieser Abschnitt beleuchtet die Reflexion von Unterrichtsprotokollen und Lernerbedingungsanalysen, die im Rahmen von Hospitationen im Schulpraxissemester entstanden sind.
- Unterrichtsentwurf 1: Faust: In diesem Kapitel wird ein Unterrichtsentwurf zum Thema „Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe vorgestellt und analysiert. Die Einordnung der Stunde in die längerfristige Planung, die Planungstabelle der Sequenz und die Bedingungsanalyse werden detailliert beschrieben. Die didaktische Analyse umfasst die Sachanalyse, die Lernziele und die Begründung der Unterrichtsstruktur.
- Unterrichtsentwurf II: „Märchen aus aller Welt“: Dieser Abschnitt befasst sich mit einem Unterrichtsentwurf zum Thema „Märchen aus aller Welt“. Die Einordnung der Stunde in die Sequenz, die Lehrplanbezüge und die Konzeption der Sequenz werden dargestellt. Die Bedingungsanalyse, die Sachanalyse und die didaktische Analyse mit den Lernzielen und der Begründung der Unterrichtsstruktur runden den Entwurf ab.
- Studienprojekt: Differenzierung im Deutschunterricht zum Thema Flektierbare Wortarten: In diesem Kapitel wird ein Studienprojekt zur Differenzierung im Deutschunterricht vorgestellt. Es werden verschiedene Ansätze der Differenzierung, insbesondere die Lerntheke, erläutert. Die Planung und Durchführung der Lerntheke in der Unterrichtssequenz „Im Land der Wortarten“ wird detailliert beschrieben.
- Lern- und Entwicklungsprozess: Dieser Abschnitt widmet sich dem persönlichen Lern- und Entwicklungsprozess während des Schulpraxissemesters. Die Praktikumsschule, andere Aktivitäten in der Schule und die Erwartungen und Ziele an das Praktikum werden reflektiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen Schulpraxissemester, Deutschunterricht, Unterrichtsentwürfe, Didaktische Analyse, Sachanalyse, Lernziele, Differenzierung, Lerntheke, Binnendifferenzierung, Hospitation, Reflexion, Unterrichtssequenz, Märchen, Faust, Goethe, flektierbare Wortarten. Außerdem werden die Themen Kompetenzorientierung, individuelle Förderung und die Entwicklung des eigenen Lern- und Entwicklungsprozesses im Lehrerberuf beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was beinhaltet ein Portfolio für das Schulpraxissemester?
Es umfasst Hospitationsprotokolle, detaillierte Unterrichtsentwürfe, Sachanalysen und die Reflexion der eigenen Lehrerpersönlichkeit.
Wie plant man eine Unterrichtseinheit zu Goethes "Faust"?
Die Arbeit zeigt eine Sequenzplanung, die das Drama als epochenübergreifendes Werk behandelt und institutionelle Voraussetzungen einbezieht.
Was ist eine Lerntheke im Deutschunterricht?
Ein Instrument zur Binnendifferenzierung, bei dem Schüler Aufgaben zu Themen wie Wortarten in ihrem eigenen Tempo bearbeiten können.
Warum ist Differenzierung im Unterricht wichtig?
Sie ermöglicht individuelle Förderung und trägt den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen innerhalb einer Klasse Rechnung.
Wie werden Märchen im Unterricht didaktisch aufbereitet?
Der Entwurf nutzt "Märchen aus aller Welt", um strukturelle Merkmale zu untersuchen und die Schreibkompetenz der Schüler zu fördern.
- Arbeit zitieren
- Michelle Hofer (Autor:in), 2022, Portfolio für das Schulpraxissemester im Fach Deutsch. Hospitationsprotokolle, Unterrichtsentwürfe und Studienprojekt, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1248144