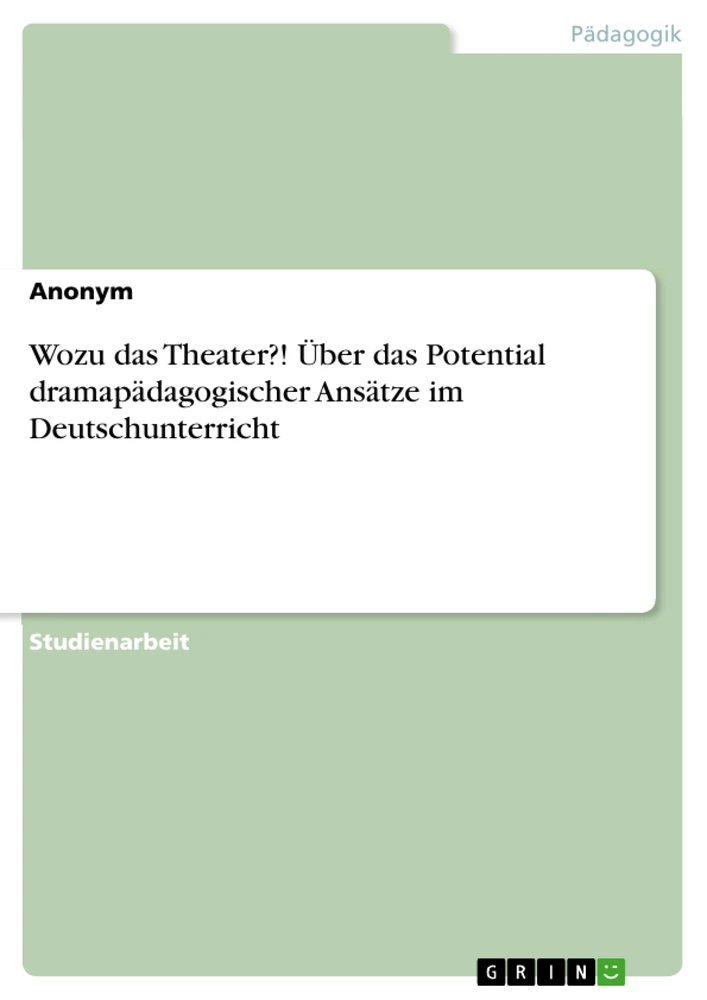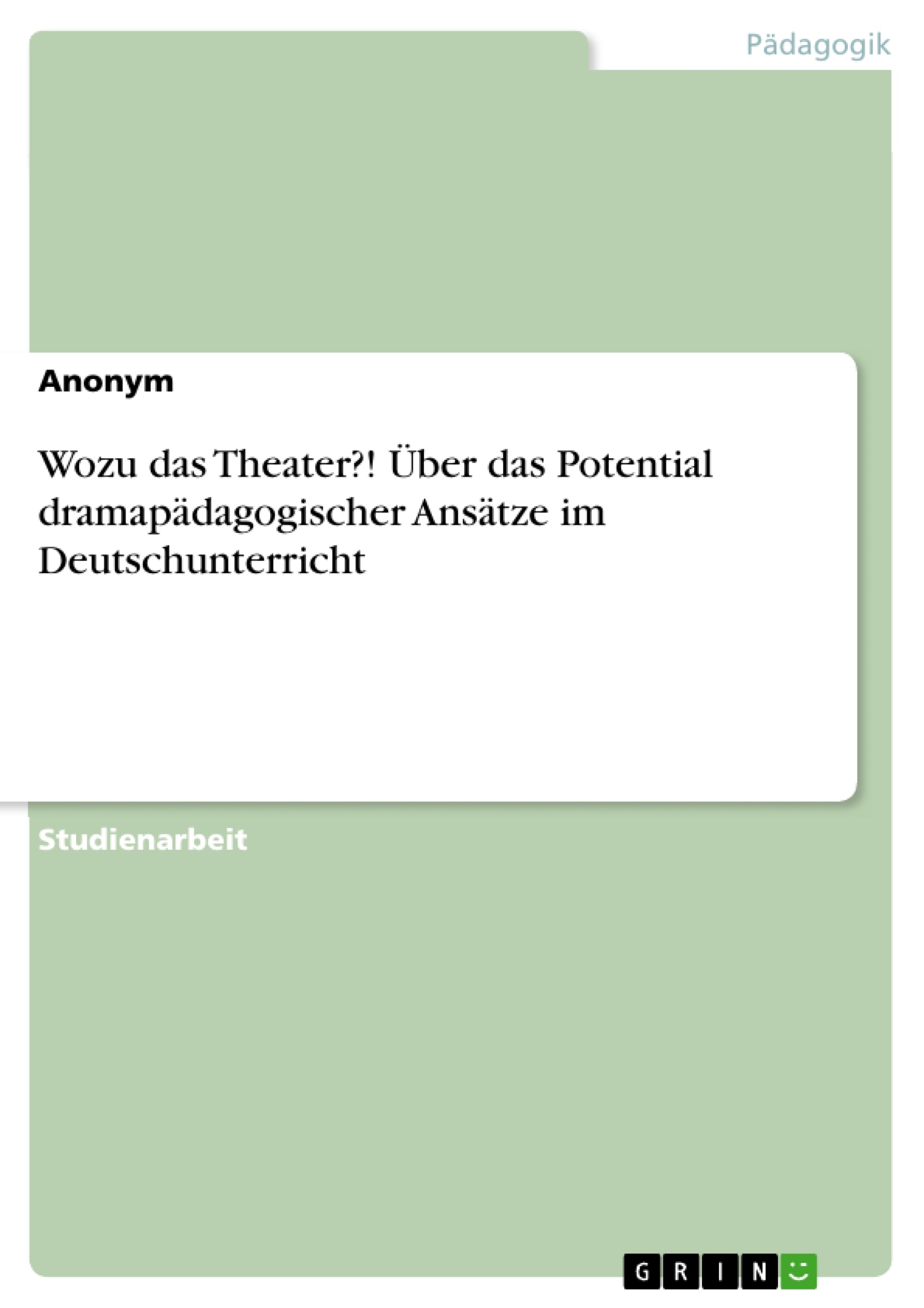Die Arbeit untersucht das Potential dramapädagogischer Ansätze im Deutschunterricht. Vor dem Hintergrund der Bildungsstandards und den im Bremer Bildungsplan festgelegten Kompetenzzielen der Sekundarstufe I wird erörtert, inwiefern sich dramatische Methoden zur Erreichung der Lehr- und Lernziele eignen. Als Grundlage dient eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Dramapädagogik. Davon ausgehend, dass dramapädagogische Formen sich als Theatralisierung von Lerninhalten durch auf- und vorführungsbezogene Methoden des Theaters charakterisieren lassen, schließt Dramapädagogik die Arbeit mit sämtlichen medialen Erscheinungen ein, sodass sie besonders geeignet erscheint, um Inhalte des Deutschunterrichts zu erarbeiten.
Um eine Einschätzung der Möglichkeiten von Dramapädagogik des Fachunterrichts Deutsch zu erlangen, wird zunächst eine Übersicht über verschiedene dramatische Ansätze gegeben, bevor ausgewählte Ansätze genauer beleuchtet werden. Im Anschluss daran erfolgt eine genaue Auseinandersetzung mit den Bildungsstandards und dem Bildungsplan Bremens, die der Frage nach der Passung der Methoden zur Erreichung der Lernziele nachgeht. Dabei wird sich sowohl auf überfachliche als auch fachliche Kompetenzen bezogen, die es im Deutschunterricht weiterzuentwickeln gilt.
Um eine Einbindung in den Unterricht exemplarisch nachvollziehen zu können und die Entwicklung der Kompetenzen konkreter zu gestalten, folgt die Planung einer Unterrichtsstunde zum Thema Großstadtlyrik unter Einbezug der zuvor vorgestellten Methoden. Im Rahmen dieser Arbeit muss auf die Durchführung und Evaluation zwar verzichtet werden, allerdings bietet der Unterrichtsvorschlag eine Anregung nach dem Mehrwert dramapädagogischer Ansätze gegenüber anderen Methoden des Deutschunterrichts zu fragen. Diesem Umstand soll in einer abschließenden kritischen Reflexion Rechnung getragen werden, die neben den Möglichkeiten der Dramapädagogik auch Herausforderungen und Grenzen aufzeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Dramapädagogik
- Dramapädagogische Ansätze
- Standbild
- Rollenspiel
- Theaterprojekt
- Dramapädagogik im Deutschunterricht
- Überfachliche Lehr- und Lernziele
- Fachliche Lehr- und Lernziele
- Bildungsstandards
- Bremer Bildungsplan
- Kritische Reflexion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Potenzial von dramapädagogischen Ansätzen im Deutschunterricht. Sie beleuchtet die Eignung dramatischer Methoden zur Erreichung von Lehr- und Lernzielen im Kontext der Bildungsstandards und des Bremer Bildungsplans für die Sekundarstufe I.
- Definition und Charakteristika der Dramapädagogik
- Überblick über verschiedene dramapädagogische Ansätze
- Analyse der Passung von Dramapädagogik zu den Bildungsstandards und dem Bremer Bildungsplan
- Exemplarische Planung einer Unterrichtsstunde zur Einbindung dramapädagogischer Methoden
- Kritische Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen von Dramapädagogik im Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt das Thema der Arbeit ein und erläutert die Fragestellung: Inwiefern eignen sich dramapädagogische Methoden zur Erreichung der Lehr- und Lernziele im Deutschunterricht? Die Einleitung legt den Fokus auf die Relevanz dramapädagogischer Ansätze im Hinblick auf die Bildungsstandards und den Bremer Bildungsplan.
- Dramapädagogik: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff "Dramapädagogik" und seiner Bedeutung für den pädagogischen Kontext. Es werden die verschiedenen Dimensionen des "Dramatischen" untersucht und der enge Zusammenhang zwischen Drama und Theater hervorgehoben.
- Dramapädagogische Ansätze: Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über unterschiedliche dramapädagogische Ansätze, insbesondere im Kontext des Fremdsprachenunterrichts. Es werden nonverbale Übungen wie Standbilder, Rollenspiele und Theaterprojekte als Beispiele für dramapädagogische Methoden vorgestellt und deren Stärken und Einsatzmöglichkeiten beleuchtet.
- Dramapädagogik im Deutschunterricht: Dieses Kapitel untersucht die Eignung von Dramapädagogik im Deutschunterricht, indem es überfachliche und fachliche Lehr- und Lernziele betrachtet. Es analysiert den Bezug der dramapädagogischen Ansätze zu den Bildungsstandards und dem Bremer Bildungsplan.
Schlüsselwörter
Dramapädagogik, Deutschunterricht, Bildungsstandards, Bremer Bildungsplan, Theatralisierung, Lernprozess, Standbild, Rollenspiel, Theaterprojekt, Überfachliche Kompetenzen, Fachliche Kompetenzen, Großstadtlyrik.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Wozu das Theater?! Über das Potential dramapädagogischer Ansätze im Deutschunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1247559