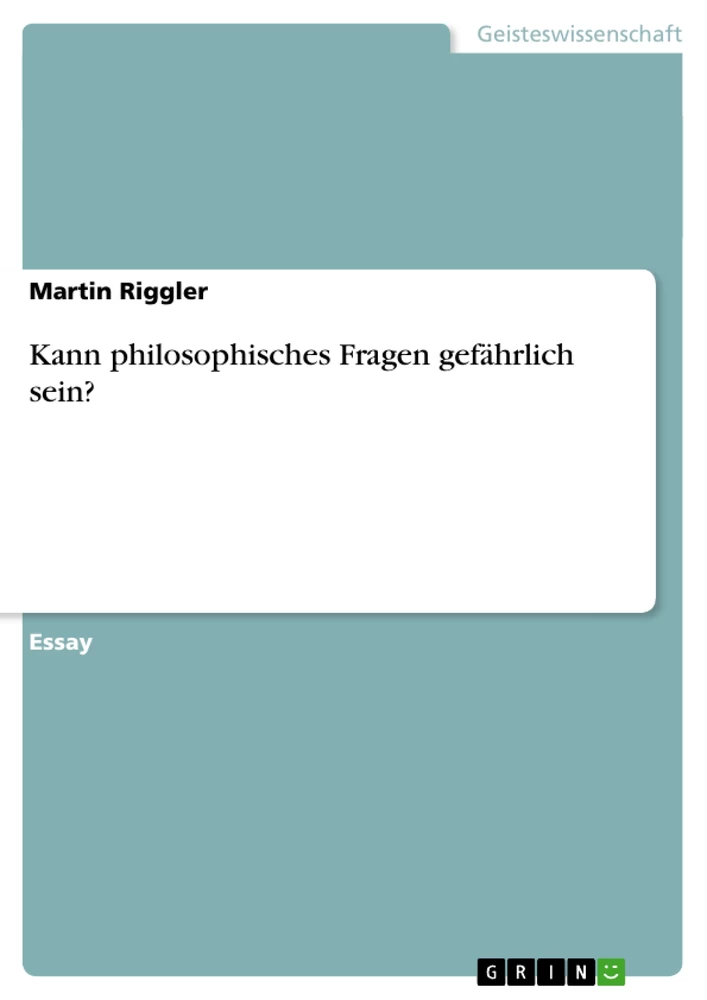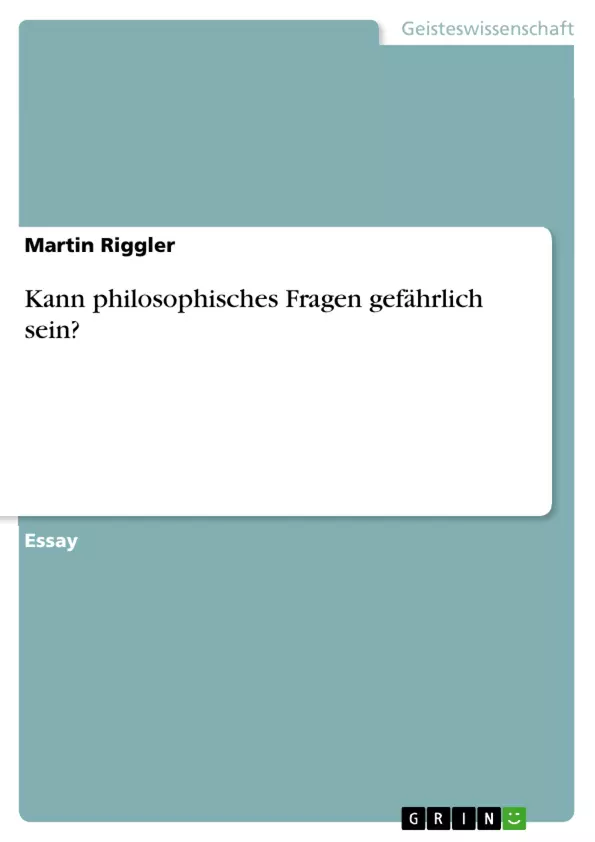Auf diese Frage versucht der folgende Text eine Antwort zu finden, er soll zugleich als
Grundlage für die Präsentation zum Thema dienen, als auch Veranschaulichen und Vertiefen.
Im Hinblick auf Sokrates (* 469 v. Chr.; † 399 v. Chr.; für das abendländische Denken
grundlegender antiker griechischer Philosoph; durch Gift hingerichtet) und seinen
Lebensweg, insbesondere sein Ableben, liegt eine (vor-)schnelle und eindimensionale
Antwort nahe. Sein Schicksal, ebenso wie das anderer Denker durch die Geschichte
hindurch, beispielsweise Thomas Morus (engl.: Thomas More; * 7. Februar 1487; † 6. Juli
1535; ein englischer Staatmann und humanistischer Autor; hingerichtet durch das Beil) oder
Dietrich Bonhoeffer (* 4. Februar 1906; † 9. April 1945; deutscher evangelisch-lutherischer
Theologe, Vertreter der Bekennenden Kirche und Widerstandkämpfer gegen den
Nationalsozialismus; ermordet im KZ Flossenbürg) ergeben ein deutliches Bild:
Philosophisches Fragen kann letzten Endes, wie das Fragen und in Frage stellen
insbesondere, die Lebensdauer verkürzen!
Doch dahinter steckt noch mehr – zunächst betrachtet werden soll die direkte Gefährdung
dessen, was dem Geisteswissenschaftler an sich das höchste Gut zu sein scheint:
Inhaltsverzeichnis
- Kann philosophisches Fragen gefährlich sein?
- Direkte Gefährdung des intellektuellen Gebäudes
- Weltliche Tragweite der Philosophie: Sokrates' Tod
- Der Dialog zwischen Sokrates und Kriton
- Kritons Argumente für die Flucht
- Sokrates' dialektische Argumentation
- Hegels Dialektik des Gewissens
- Deontologisches Element und Sokrates' Entscheidung
- Platons Höhlengleichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Frage, ob philosophisches Fragen gefährlich sein kann. Er beleuchtet verschiedene Aspekte dieser Frage, ausgehend von historischen Beispielen wie Sokrates, Thomas Morus und Dietrich Bonhoeffer. Der Text analysiert sowohl die unmittelbare Gefährdung des intellektuellen Systems des Philosophen als auch die weitreichenden Konsequenzen philosophischen Denkens für das reale Leben.
- Gefährdung des intellektuellen Gebäudes durch philosophische Reflexion
- Weltliche Konsequenzen philosophischen Denkens am Beispiel Sokrates
- Der Dialog als Methode der philosophischen Auseinandersetzung (Mäeutik)
- Hegels Dialektik des Gewissens und die ethische Dimension
- Deontologische Aspekte im Handeln und die Bewertung von Absicht vs. Konsequenz
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit der These, dass philosophisches Fragen gefährlich sein kann, belegt durch historische Beispiele von Philosophen, die aufgrund ihres Denkens verfolgt und getötet wurden. Anschließend wird die Gefährdung des eigenen intellektuellen Systems durch die ständige Hinterfragung von Überzeugungen thematisiert. Es folgt eine Analyse von Sokrates' Tod und dessen Zusammenhang mit seinem philosophischen Denken, wobei sein Dialog mit Kriton im Detail untersucht wird. Der Text bezieht Hegel's Dialektik des Gewissens ein und diskutiert die deontologischen Aspekte von Sokrates' Entscheidung, im Gefängnis zu bleiben. Schließlich wird Platons Höhlengleichnis als Metapher für die Herausforderungen und Folgen philosophischen Denkens erwähnt.
Schlüsselwörter
Philosophisches Fragen, Gefährlichkeit, Sokrates, Thomas Morus, Dietrich Bonhoeffer, Mäeutik, Dialektik des Gewissens (Hegel), Deontologie, Platons Höhlengleichnis, Intellektuelles Gebäude, Weltliche Konsequenzen, Gewissensentscheidung, Recht und Pflicht.
Häufig gestellte Fragen
Kann philosophisches Fragen lebensgefährlich sein?
Historische Beispiele wie Sokrates, Thomas Morus oder Dietrich Bonhoeffer zeigen, dass das radikale Hinterfragen bestehender Ordnungen tödliche Konsequenzen haben kann.
Warum wurde Sokrates hingerichtet?
Sokrates wurde wegen "Verderbens der Jugend" und "Einführung neuer Götter" angeklagt, da sein ständiges Fragen die Autorität des Staates und der Tradition untergrub.
Was symbolisiert Platons Höhlengleichnis in diesem Kontext?
Es beschreibt die Gefahr für den Philosophen, der zur Wahrheit gelangt ist und versucht, die anderen (die Gefangenen in der Höhle) zu befreien, dabei aber auf tödlichen Widerstand stößt.
Was ist Hegels "Dialektik des Gewissens"?
Hegel untersucht den Konflikt zwischen der individuellen moralischen Überzeugung (Gewissen) und den geltenden Gesetzen des Staates (Sittlichkeit).
Was bedeutet "Mäeutik"?
Mäeutik ist die sokratische "Hebammenkunst" des Dialogs, bei der durch gezieltes Fragen der Gesprächspartner selbst zur Erkenntnis geführt wird.
- Arbeit zitieren
- Martin Riggler (Autor:in), 2008, Kann philosophisches Fragen gefährlich sein?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/124755