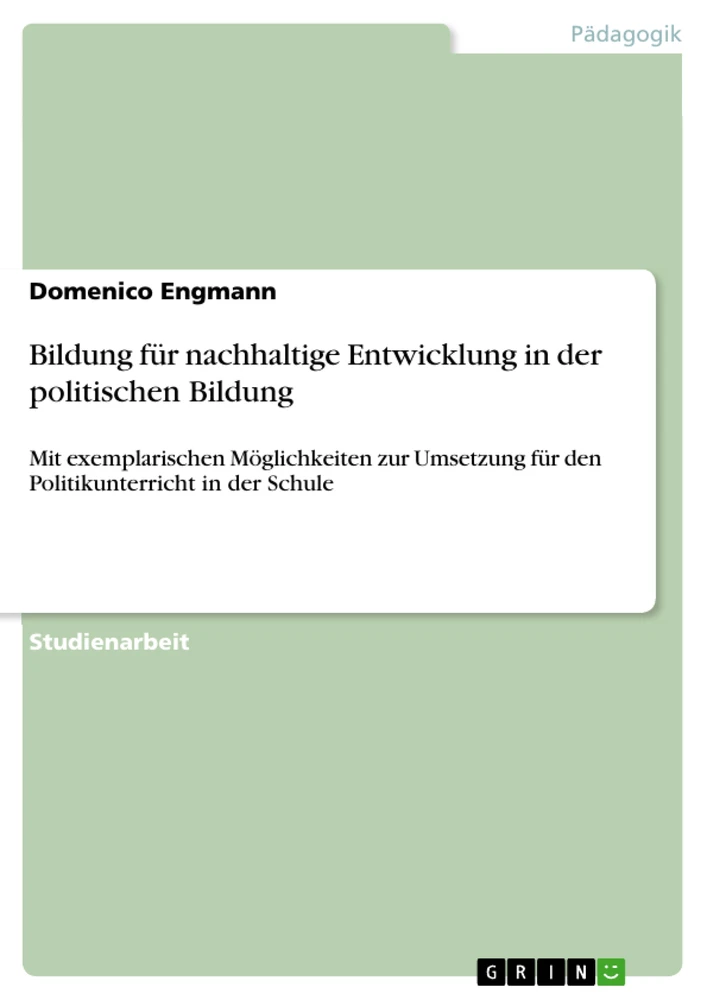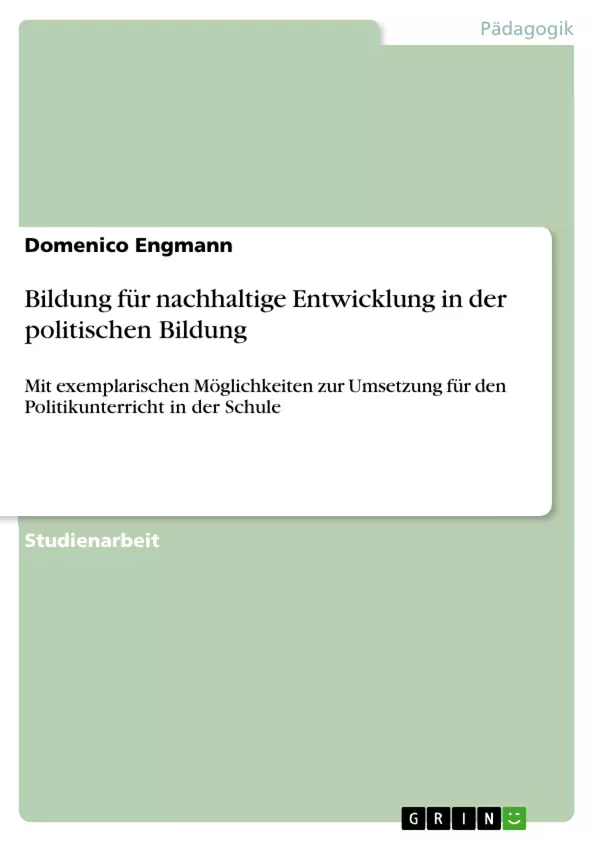In dieser Arbeit soll auf folgende Fragen eingegangen werden: Was bedeutet der Begriff der Nachhaltigkeit und welche Entwicklungen durchlief er in den letzten 300 Jahren? Aus welchen Gründen erließen die Vereinten Nationen die ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ und wie veränderte dies die politische Bildung in der Schule? Welche Ziele verfolgt die Bildung für nachhaltige Entwicklung und wie wirkt sich das auf uns aus? Welche Relevanz hat die Bildung für nachhaltige Entwicklung für die politische Bildung und wo ist diese im bayerischen LehrplanPLUS zu verorten? Inwiefern sind die Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung und der Beutelsbacher Konsens als Grundlage der politischen Bildung vereinbar? Wie kann die Umsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis aussehen?
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist seit Jahren in aller Munde, nicht nur wegen der verstärkten Forderung nach mehr Umweltschutz der ‚Fridays For Future‘-Demonstrierenden, sondern auch aufgrund der aktuellen Brisanz. Eine stetig zunehmende Menge an Plastikmüll in den Weltmeeren, Mikroplastik in Lebensmitteln und im Grundwasser, sich häufende Naturkatastrophen und der Klimawandel führten nicht nur zu strengeren Gesetzen und Regeln, sondern auch zu einem Umdenken vieler Menschen in ihrem Privat- und Berufsleben. Viele nehmen häufiger mal das Fahrrad, um in die Arbeit zu fahren und verzichten beim Einkaufen auf Lebensmittel in Plastikverpackungen. Im beruflichen Bereich stellten viele Landwirte ihren Betrieb zu mehr Nachhaltigkeit um. Im Jahr 2020 lag der Anteil der Landwirte in Deutschland, die ihren Betrieb ökologisch bewirtschafteten, bei ungefähr 10 Prozent.
‚Nachhaltig leben‘ oder ‚nachhaltig einkaufen‘ ist zum Trend geworden und nicht selten werden andere, die diesem Trend nicht nachgehen und den Discounter mit vollen Plastiktüten verlassen, kritisch beäugt. Doch was bedeutet ein nachhaltiger Lebensstil eigentlich? Mit dem neuen SUV zum fünf Kilometer entfernten Bio-Laden zu fahren oder im Supermarkt alles in Plastikverpackungen zu kaufen, sicher nicht. Beim Einkauf darauf zu achten, ob die Produkte auch regional verfügbar sind und diese nur in der richtigen Saison zu kaufen oder öfter mal das Fahrrad zu nehmen, wohl eher. Aber in dieser Debatte über nachhaltig leben oder nicht, erscheint es doch, dass der Nachhaltigkeitsbegriff in den letzten Jahren einen gewissen Bedeutungsverlust durchlaufen hat und häufig inflationär verwendet wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Nachhaltigkeit als Lebensstil
- 2. Der Begriff der Nachhaltigkeit
- 2.1. Die Geschichte des Nachhaltigkeitsbegriffes
- 2.2 Der Versuch einer Definition des Begriffs der Nachhaltigkeit
- 3. BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung
- 3.1 Der Begriff der Bildung für nachhaltige Entwicklung
- 3.2 Geschichte der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
- 3.3 AGENDA 2030 - Die Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung
- 3.4 Die drei Zieldimensionen der Nachhaltigkeit
- 3.5 Relevanz und Bedeutung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
- 4. Der Beutelsbacher Konsens und BNE im Spannungsverhältnis
- 4.1 Die drei didaktischen Grundprinzipien der politischen Bildung
- 4.2 Vereinbarkeit der Bildung für nachhaltige Entwicklung mit dem Beutelsbacher Konsens
- 5. Bezug zum LehrplanPLUS
- 5.1 Politische Bildung in der Schule
- 5.2 Die gesetzliche Verankerung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule
- 5.3 Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele, Alltagskompetenz und Lebensökonomie
- 5.4 Verortung des Themas im LehrplanPLUS der bayerischen Mittelschulen
- 5.5 Kompetenzen und Ziele im LehrplanPLUS
- 6. Fünf exemplarische Möglichkeiten der Umsetzung in der Politischen Bildung
- 7. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung und Relevanz der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Kontext der politischen Bildung.
- Entwicklung und Bedeutung des Nachhaltigkeitsbegriffes
- Historische und aktuelle Aspekte der BNE
- Verknüpfung von BNE mit dem Beutelsbacher Konsens
- Einbettung von BNE im LehrplanPLUS
- Exemplarische Umsetzungsmöglichkeiten von BNE in der politischen Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung führt den Leser in das Thema „Nachhaltigkeit als Lebensstil“ ein und beleuchtet die aktuelle Relevanz des Begriffs im gesellschaftlichen Kontext.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs der Nachhaltigkeit und erörtert dessen historischen Wandel. Es beleuchtet die Entstehung des Begriffs in der Forstwirtschaft und zeigt die verschiedenen Definitionen und Entwicklungen des Nachhaltigkeitsgedankens auf.
- Kapitel 3: Hier wird der Begriff der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) näher erläutert und die Geschichte der BNE sowie die Ziele der Agenda 2030 vorgestellt. Die drei Zieldimensionen der Nachhaltigkeit werden vorgestellt und die Relevanz der BNE für die politische Bildung wird betont.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel wird die Verbindung zwischen dem Beutelsbacher Konsens und der BNE untersucht. Die drei didaktischen Grundprinzipien der politischen Bildung werden erläutert und es wird analysiert, inwieweit die BNE mit diesen Prinzipien vereinbar ist.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel befasst sich mit dem LehrplanPLUS und der Verortung der BNE in der bayerischen Schule. Die gesetzliche Verankerung von BNE in der Schule wird erläutert und die entsprechenden Inhalte und Kompetenzen im LehrplanPLUS werden dargestellt.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel präsentiert fünf exemplarische Möglichkeiten zur Umsetzung der BNE in der politischen Bildung in der 8. Jahrgangsstufe einer bayerischen Mittelschule zum Thema Landwirtschaft.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Beutelsbacher Konsens, LehrplanPLUS, politische Bildung, Umweltschutz, Natur, Ressourcen, Nachhaltigkeitsprinzip, Agenda 2030.
- Quote paper
- Domenico Engmann (Author), 2022, Bildung für nachhaltige Entwicklung in der politischen Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1247385