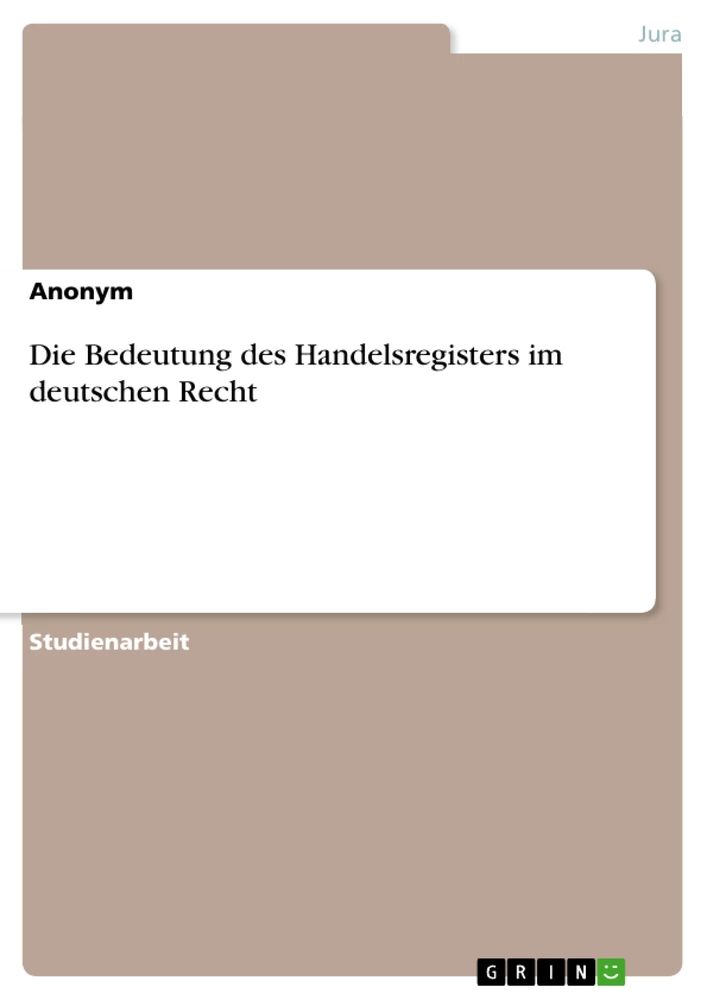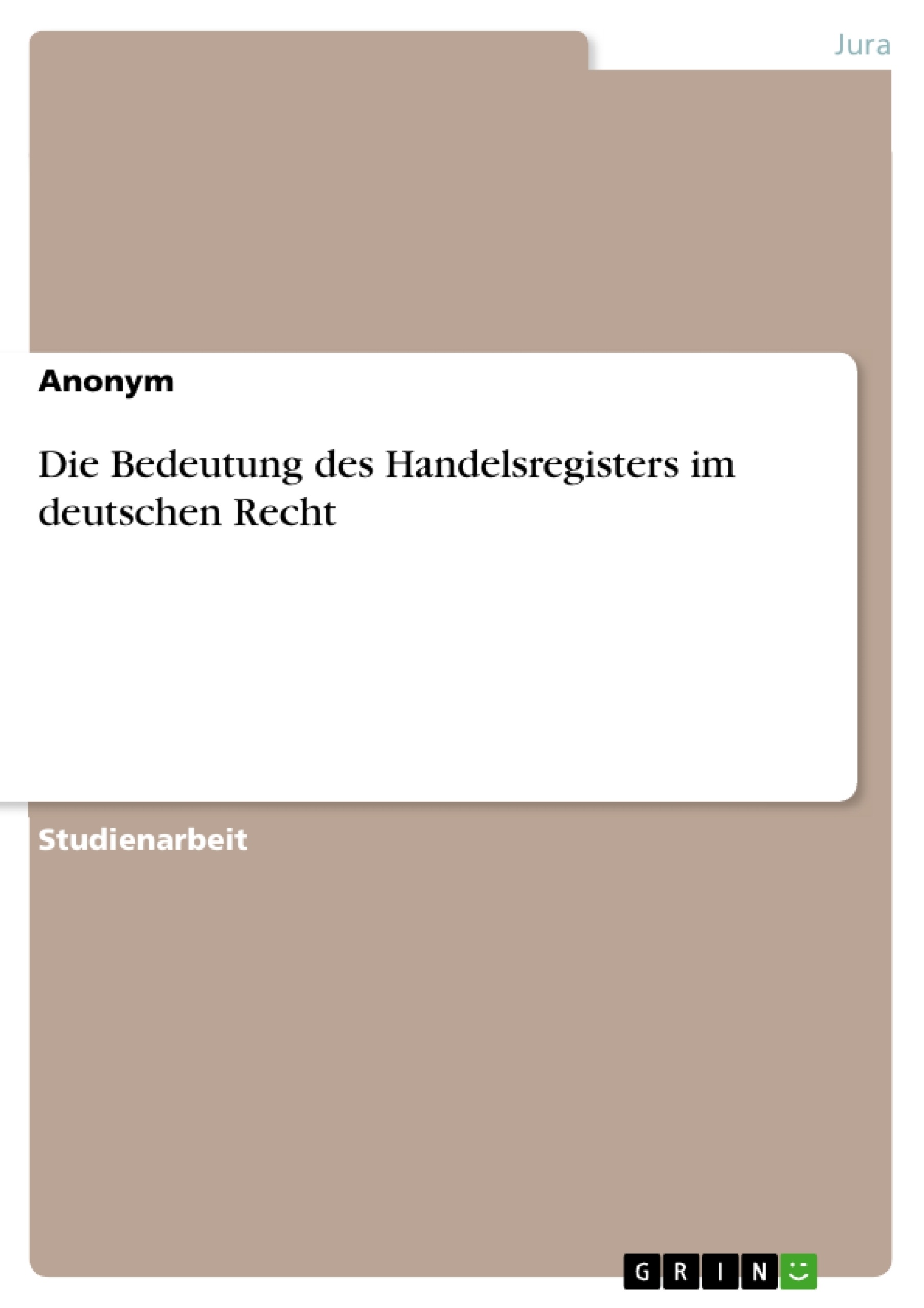Die Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung des Handelsregisters im deutschen Recht. Die Einführung in die Thematik erfolgt zunächst durch einen deskriptiven Teil. Beginnend mit einer allgemeinen Begriffsbestimmung und den dem Handelsregister zugrunde liegenden Rechtsgrundlagen, weiter mit dem Aufbau des Handelsregisters über dessen Inhalt zu den Funktionen. Hierbei werden die einzelnen Funktionen so ausgearbeitet, dass eine Auflistung derer zustande kommt. Dabei ist bereits die Bedeutung des Handelsregisters in seinen Grundzügen abzuleiten. Um diese weiter auszuführen und einen geeigneten Praxistransfer herzustellen, wird von dem Autor das BGH-Urteil vom 01. Dezember 1975 zum „Rosinentheoriefall“ herangezogen.
Nach der Darstellung des Sachverhalts folgt das Ergebnis des BGH-Urteils in kurzer Veranschaulichung. Um dieses vollumfänglich nachvollziehen zu können, folgt das Ergebnis noch einmal im Gutachterstil. Im Fazit werden die einzelnen Funktionen und deren Bedeutung in komprimierter Form zusammengefasst. Fortführend wird das Ziel der bereits unter Punkt 2 erwähnten EU-Richtlinien erklärt, um abschließend auf die Problematik eines einheitlichen europaweiten Handelsregisters einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Begriffsbestimmung „Handelsregister“ und seine Rechtsgrundlagen
- Aufbau des Handelsregisters
- Inhalt des Handelsregisters
- Die Funktionen des Handelsregisters
- Informations-, Publizitäts- und Schutzfunktion
- Kontrollfunktion
- Beweisfunktion
- Die Rechtsprechung zu den Funktionen des Handelsregisters
- Darstellung des BGH-Urteils vom 01. Dezember 1975 – „Rosinentheoriefall“
- Ergebnis des BGH-Urteils vom 01. Dezember 1975 – „Rosinentheoriefall“
- Bedeutung des Handelsregisters anhand des BGH-Urteils vom 01. Dezember 1975
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Bedeutung des Handelsregisters im deutschen Recht und zeigt die Notwendigkeit eines solchen Registers auf, das die Interessen aller Beteiligten im Handelsrecht schützt. Die Arbeit beleuchtet die geschichtlichen Wurzeln des Handelsregisters und die Entwicklung seiner rechtlichen Grundlagen, insbesondere im Kontext der §§ 8ff. HGB.
- Rechtsgrundlagen des Handelsregisters
- Aufbau und Inhalt des Handelsregisters
- Funktionen des Handelsregisters (Informations-, Publizitäts-, Kontroll- und Beweisfunktion)
- Bedeutung des Handelsregisters im Kontext der Rechtsprechung, insbesondere anhand des „Rosinentheoriefall“
- Ziele der EU-Richtlinien und die Problematik eines einheitlichen europäischen Handelsregisters
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort führt in das Thema der Seminararbeit ein und beleuchtet die Notwendigkeit des Handelsregisters im Kontext der geschichtlichen Entwicklung des Handelsrechts.
- Kapitel 2 definiert den Begriff des Handelsregisters und beleuchtet die relevanten Rechtsgrundlagen, wie die §§ 8 – 16 HGB, die §§ 378 bis 399 FamFG und die HRV. Auch EU-Richtlinien wie die Richtlinie 89/666 EWG und die Richtlinie 2012/17/EU werden im Kontext des Handelsregisters erwähnt.
- Kapitel 3 beschreibt den Aufbau des Handelsregisters gemäß der HRV und die Gliederung in Abteilung A (HRA) und Abteilung B (HRB). Hier werden auch die verschiedenen Registerblätter und Dokumente sowie die elektronische Führung des Handelsregisters seit 2007 erklärt.
- Kapitel 4 erläutert den Inhalt des Handelsregisters und unterscheidet zwischen eintragungsfähigen und nicht eintragungsfähigen Tatsachen, wobei zwischen eintragungspflichtigen und nicht eintragungspflichtigen Tatsachen unterschieden wird. Die Sicherheit im Rechtsverkehr spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.
- Kapitel 5 untersucht die Funktionen des Handelsregisters, insbesondere die Informations-, Publizitäts- und Schutzfunktion. Der Fokus liegt auf der Erfassung von Sachverhalten, die im Handelsregister eingetragen werden müssen, um Transparenz im Rechtsverkehr zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Handelsregister, einem öffentlichen Register, das wichtige Informationen über privatrechtliche Rechtstatsachen und Rechtsverhältnisse im Handels- und Gesellschaftsrecht veröffentlicht. Die Arbeit beleuchtet die Rechtsgrundlagen des Handelsregisters, seinen Aufbau und Inhalt, sowie die Funktionen des Handelsregisters wie Informations-, Publizitäts-, Kontroll- und Beweisfunktion. Zudem werden die Rechtsprechung und die Bedeutung des Handelsregisters anhand des „Rosinentheoriefall“ analysiert.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Die Bedeutung des Handelsregisters im deutschen Recht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1247260