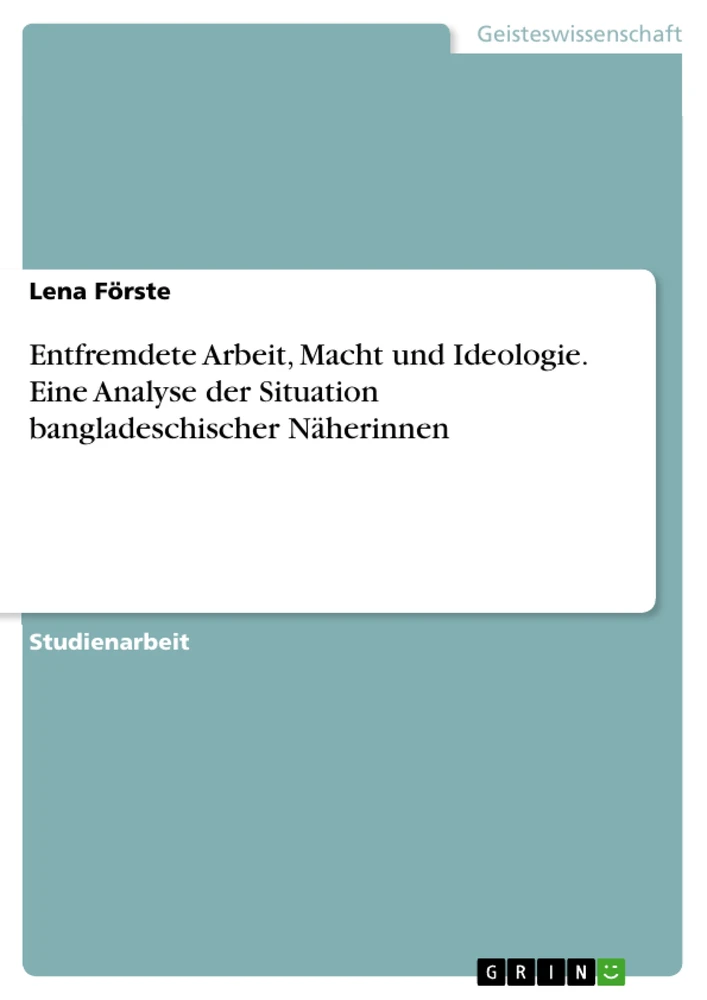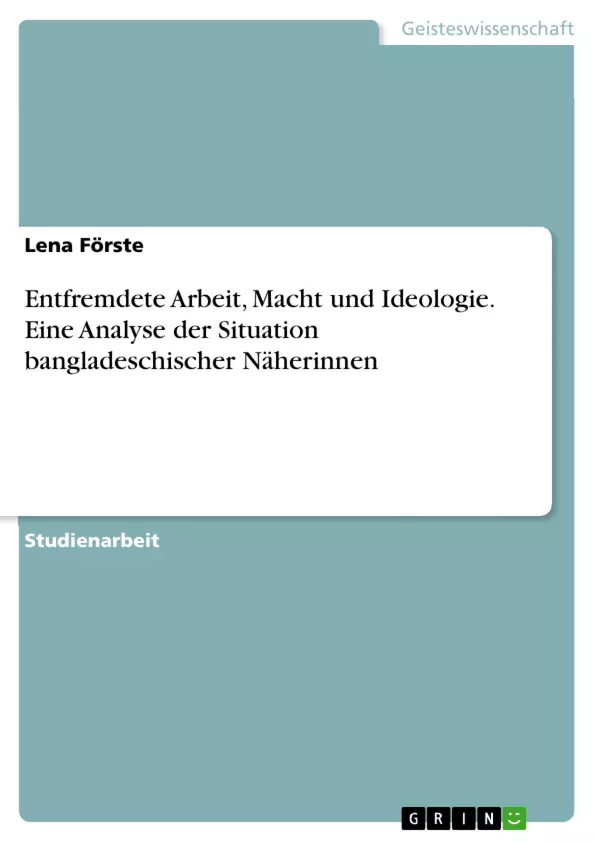In der folgenden Arbeit werde ich mich schwerpunktmäßig mit den sozialphilosophischen Konzepten der entfremdeten Arbeit, der dreidimensionalen Macht und der Ideologie auseinandersetzen, wobei ich diese zunächst rekonstruiere und anschließend miteinander verknüpfe. Durch Anwendung dieser werde ich mich mit der Situation der Näherinnen in Bangladesch befassen. Dazu stelle ich die Hypothese auf, dass es sich bei der beschriebenen gesellschaftlichen Lage um eine „Pathologie des Sozialen“ handelt. Nach Honneth sind Pathologien des Sozialen gesellschaftliche Fehlentwicklungen oder Störungen, die das Individuum darin beeinträchtigen, ein gutes Leben innerhalb der Gesellschaft zu führen. Dieser Ausarbeitung liegt eine theoretische, textanalytische Methode zu Grunde, die sich insbesondere auf Marx‘ Ökonomisch-philosophische Manuskripte als Primärquelle stützt. Weiterhin wird auf die drei Dimensionen der Macht nach Lukes eingegangen und sie werden mit der entfremdeten Arbeit in Verbindung gebracht. Anschließend wird der Begriff der Ideologie erklärt und in Zusammenhang mit den vorherigen Konzepten gebracht. Nachdem diese drei Konzepte zunächst rekonstruiert und miteinander verknüpft wurden, folgt anschließend ein Teil, in welchem diese Konzepte auf die Situation der Näherinnen in Bangladesch angewendet werden. Durch eine Analyse der zeitgenössischen ökonomischen Zustände wird untersucht, ob die momentane Lage der Gesellschaft auf eine Pathologie hindeutet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ethische Kriterien der Arbeit
- Die entfremdete Arbeit nach Marx
- Rekonstruktion der entfremdeten Arbeit nach Marx
- Entfremdete Arbeit als Pathologie des Sozialen
- Entfremdete Arbeit und die drei Dimensionen der Macht
- Ideologie, Macht und entfremdete Arbeit
- Anwendung der Konzepte auf die Arbeit bangladeschischer Frauen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse der Situation bangladeschischer Näherinnen im Kontext der entfremdeten Arbeit, Macht und Ideologie. Sie untersucht, ob die Situation der Näherinnen als eine „Pathologie des Sozialen“ interpretiert werden kann, die das Individuum in seinem Streben nach einem guten Leben in der Gesellschaft behindert.
- Rekonstruktion und Analyse des Konzepts der entfremdeten Arbeit nach Marx
- Verknüpfung von entfremdeter Arbeit mit dem Konzept der sozialen Pathologie
- Erörterung der drei Dimensionen der Macht nach Lukes
- Verbindung von Ideologie mit den Konzepten der entfremdeten Arbeit und Macht
- Anwendung der Konzepte auf die Situation der Näherinnen in Bangladesch
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und skizziert den gesellschaftlichen Hintergrund der Analyse, insbesondere den Aspekt der Globalisierung des Weltmarktes und die besondere Stellung der Arbeit von Frauen.
- Ethische Kriterien der Arbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Arbeit für das Individuum und stellt Kriterien auf, anhand derer man die Qualität von Arbeit beurteilen kann. Es wird argumentiert, dass Arbeit kreativ, kooperativ, solidarisch, transparent, abwechslungsreich und sinnvoll sein sollte, um die Selbstwerdung des Menschen zu ermöglichen.
- Die entfremdete Arbeit nach Marx: Hier wird das Konzept der entfremdeten Arbeit nach Marx rekonstruiert. Die Analyse umfasst die verschiedenen Formen der Entfremdung und ihre Auswirkungen auf das Individuum.
- Entfremdete Arbeit und die drei Dimensionen der Macht: Dieses Kapitel verbindet das Konzept der entfremdeten Arbeit mit den drei Dimensionen der Macht nach Lukes. Es werden die unterschiedlichen Formen der Macht und ihre Rolle bei der Produktion und Reproduktion von Entfremdung diskutiert.
- Ideologie, Macht und entfremdete Arbeit: In diesem Kapitel wird der Begriff der Ideologie erläutert und in Zusammenhang mit den vorherigen Konzepten der entfremdeten Arbeit und Macht gebracht. Es wird untersucht, wie Ideologie die Wahrnehmung von Macht und Entfremdung beeinflusst.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: entfremdete Arbeit, soziale Pathologie, Macht (dreidimensional), Ideologie, Globalisierung, Bangladesch, Näherinnen, Frauenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Marx unter „entfremdeter Arbeit“?
Marx beschreibt, dass Arbeiter im Kapitalismus vom Produkt ihrer Arbeit, vom Arbeitsprozess, von ihrem Gattungswesen und von ihren Mitmenschen entfremdet werden.
Warum wird die Situation in Bangladesch als „Pathologie des Sozialen“ bezeichnet?
Nach Honneth handelt es sich um eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, die Individuen (hier Näherinnen) daran hindert, ein gelingendes und würdevolles Leben zu führen.
Was sind die drei Dimensionen der Macht nach Lukes?
Diese umfassen: 1. Direkte Entscheidungs-Macht, 2. Macht durch Setzen der Agenda (Nicht-Entscheidungen) und 3. Ideologische Macht zur Beeinflussung von Wünschen und Gedanken.
Welche Rolle spielt Ideologie bei der Ausbeutung von Frauen?
Ideologien können ungerechte Machtverhältnisse als natürlich oder unveränderbar erscheinen lassen, sodass Betroffene ihre eigene Unterdrückung nicht mehr als solche wahrnehmen.
Welche ethischen Kriterien sollte „gute Arbeit“ erfüllen?
Arbeit sollte kreativ, kooperativ, solidarisch, transparent, abwechslungsreich und sinnvoll sein, um die Selbstverwirklichung des Menschen zu ermöglichen.
Wie wirkt sich die Globalisierung auf bangladeschische Näherinnen aus?
Sie führt zu einem enormen Kostendruck und schlechten Arbeitsbedingungen, da globale Lieferketten auf maximale Profitmaximierung bei minimalen Lohnkosten setzen.
- Arbeit zitieren
- Lena Förste (Autor:in), 2015, Entfremdete Arbeit, Macht und Ideologie. Eine Analyse der Situation bangladeschischer Näherinnen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1246695