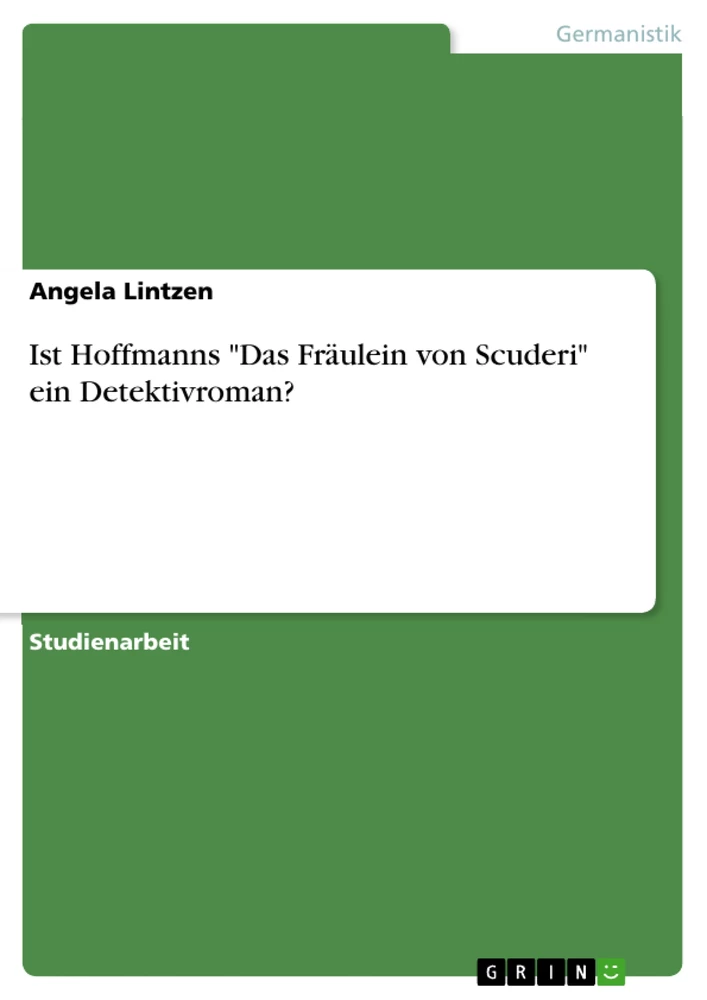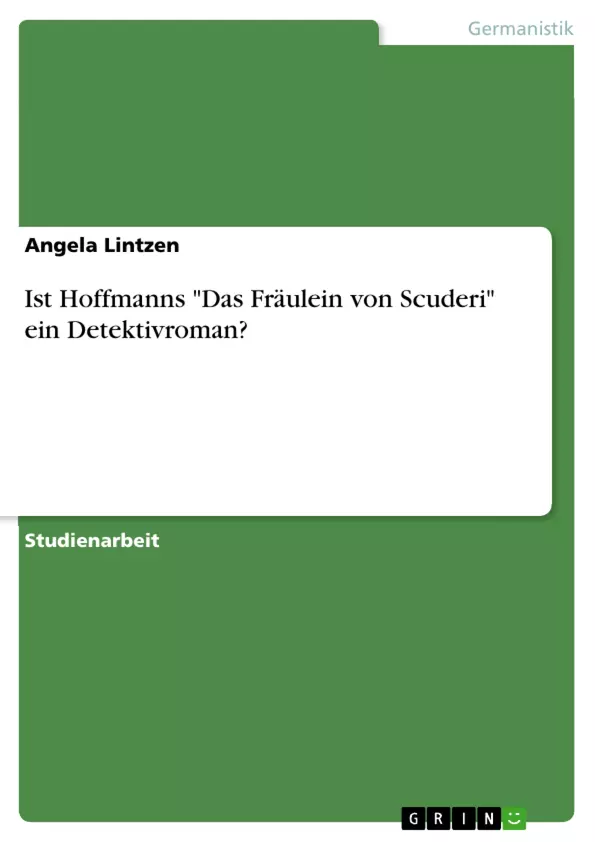Mit der These, "Das Fräulein von Scuderi" sei ein Modellfall für die idealtypische Detektivgeschichte, hat sich die Forschungsliteratur bereits beschäftigt. Auch die vorliegende Arbeit stellt diese These in den Mittelpunkt ihres Interesses.
So soll untersucht werden, welche Elemente und Strukturen Hoffmanns Erzählung als Detektivgeschichte ausweisen und welche dieser Einordnung widersprechen. Dazu ist es nötig, dem Schema einer klassischen Detektivgeschichte nachzugehen: Dabei soll zuerst auf das rätselhafte Verbrechen - die Gift- und Juwelenmorde - eingegangen werden, um anschließend der Rolle des Detektivs und seiner Detektion nachzugehen. Darüber hinaus müssen die Verdächtigen - Olivier Brusson und René Cardillac - und ihre Tatmotive näher betrachtet werden. Aus dieser Analyse der Einzelelemente soll schließlich ein Gesamtbild von Hoffmanns Erzählung entstehen, das es ermöglicht, die Frage zu beantworten, ob "Das Fräulein von Scuderi" eine Detektivgeschichte ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Problematik
- Elemente und Strukturen der Detektivgeschichte – Das Fräulein von Scuderi als Detektivgeschichte?
- Das rätselhafte Verbrechen – Die Gift- und Juwelenmorde und der Mord an René Cardillac
- Der Detektiv – Die Detektivin Scuderi und die Aufklärung des Verbrechens
- Die Verdächtigen und ihre Tatmotive – Der verdächtige Unschuldige Olivier Brusson und der unverdächtige Schuldige René Cardillac
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Das Fräulein von Scuderi" als Detektivgeschichte gelten kann. Die Untersuchung konzentriert sich dabei auf die Analyse der Elemente und Strukturen, die typischerweise in Detektivgeschichten vorkommen. Die Arbeit beleuchtet dabei insbesondere die Frage, ob die in "Das Fräulein von Scuderi" dargestellte Ermittlungsarbeit den Kriterien einer klassischen Detektivgeschichte entspricht.
- Die Problematik der Einordnung von Hoffmanns Erzählung als Detektivgeschichte
- Die Elemente und Strukturen der klassischen Detektivgeschichte
- Die Rolle des Detektivs in der Ermittlungsarbeit
- Die Analyse der Verdächtigen und ihrer Tatmotive
- Die Schlussfolgerung zur Frage, ob "Das Fräulein von Scuderi" eine Detektivgeschichte ist
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass "Das Fräulein von Scuderi" als Detektivgeschichte verstanden werden kann. Im zweiten Kapitel werden die unterschiedlichen Argumente für und gegen diese These aus der Forschungsliteratur vorgestellt und kritisch beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert die einzelnen Elemente und Strukturen der Detektivgeschichte anhand der Erzählung "Das Fräulein von Scuderi". Dabei werden die Besonderheiten der Ermittlungsarbeit, die Rolle des Detektivs und die Motive der Verdächtigen im Detail untersucht.
Schlüsselwörter
Detektivgeschichte, E.T.A. Hoffmann, Das Fräulein von Scuderi, Detektivroman, Kriminalroman, Mord, Rätsel, Verdächtige, Tatmotive, Ermittlungsarbeit, klassische Detektivgeschichte, Forschungsliteratur, Gattungsmerkmale.
- Arbeit zitieren
- Angela Lintzen (Autor:in), 2006, Ist Hoffmanns "Das Fräulein von Scuderi" ein Detektivroman?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1246608