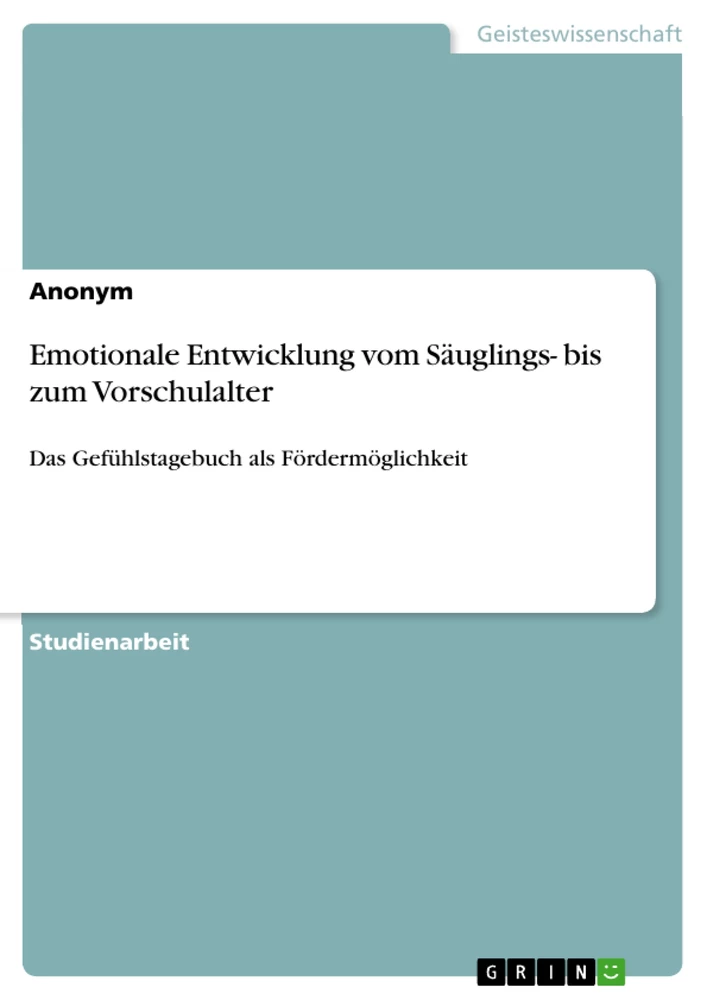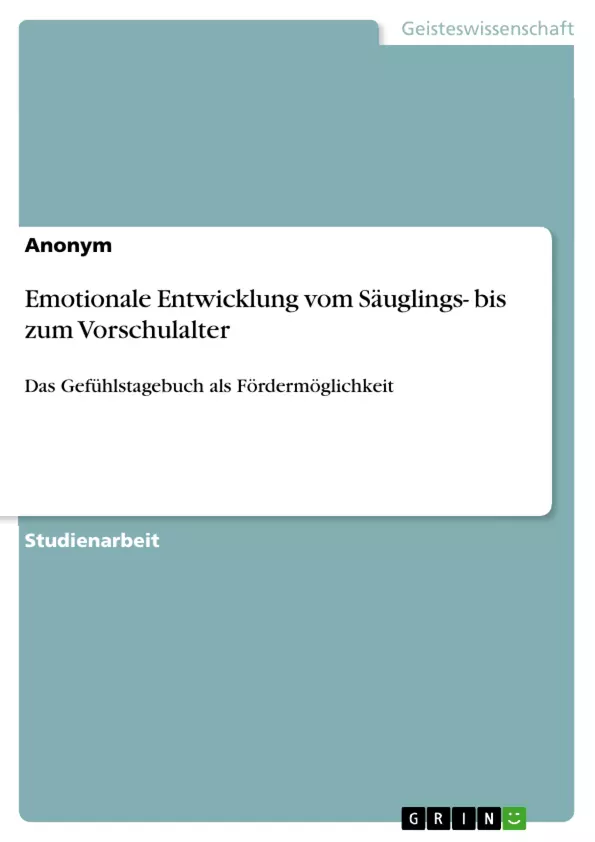Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Emotionen vom Säuglings- bis zum Vorschulalter.
In unserem Alltag gibt es kaum Situationen, in denen uns keine Emotion begleitet. Sie beeinflussen unser Handeln, Denken und unsere sozialen Kontakte. Der angemessene Umgang mit den eigenen und fremden Emotionen ist ein zentraler Entwicklungsschritt der Kindheit. Die sogenannte emotionale Kompetenz ist der Grundstein eines glücklichen Lebens mit positiven Beziehungserfahrungen.
Zunächst wird der Begriff der Emotion definiert. Es folgt ein Überblick über die Entwicklung der primären und sekundären Emotionen. Wie diese erkannt und ausgedrückt werden können und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen, sind Bestandteil des darauffolgenden Unterkapitels. Im dritten Teil liegt der Fokus auf der Praxis. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, mithilfe derer Eltern und Betreuer*innen die emotionale Entwicklung der Kinder fördern können. Einer dieser Möglichkeiten ist das Gefühlstagebuch „Ein gutes Gefühl“ für Kinder von sechs bis elf Jahren, welches als Praxisbeispiel dieser Arbeit dient. Es folgt eine Kritik zum Thema Achtsamkeit und Emotion und ein abschließendes Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.0 Die Entwicklung der Emotionen in der frühen Kindheit
- 1.1 Emotionen - Begriffserklärung
- 1.2. Entwicklung von primären Emotionen
- 2.0 Emotionale Entwicklung im Vorschulalter
- 2.1. Entwicklung sekundärer Emotionen
- 2.2 Emotionen erkennen und ausdrücken lernen
- 3.0 emotionale Kompetenz in der Praxis
- 3.1 Einfluss der Erziehung auf die emotionale Kompetenz
- 3.2. Soziale Kompetenz in der Praxis durch die Hilfe eines Gefühlstagebuches
- 3.3 Kritik
- 4.0 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die emotionale Entwicklung vom Säuglings- bis zum Vorschulalter und erörtert die Bedeutung der emotionalen Kompetenz für die Entwicklung von Kindern. Sie befasst sich mit der Definition von Emotionen, der Entwicklung von primären und sekundären Emotionen sowie der Förderung der emotionalen Kompetenz in der Praxis.
- Entwicklung von Emotionen in der frühen Kindheit
- Primäre und sekundäre Emotionen
- Emotionale Kompetenz und deren Förderung
- Einfluss der Erziehung auf die emotionale Entwicklung
- Das Gefühlstagebuch als Praxisbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der emotionalen Entwicklung ein und beleuchtet die Bedeutung der emotionalen Kompetenz für das Leben von Kindern. Kapitel 1.0 definiert den Begriff der Emotion und erläutert die Entwicklung von primären Emotionen, wie z. B. Freude, Angst, Wut und Trauer, im Säuglingsalter. Kapitel 2.0 fokussiert auf die emotionale Entwicklung im Vorschulalter und behandelt die Entwicklung sekundärer Emotionen wie Scham und Schuldgefühle, sowie die Bedeutung des Erkennens und Ausdrucks von Emotionen. Kapitel 3.0 geht auf die emotionale Kompetenz in der Praxis ein und zeigt Möglichkeiten auf, wie Eltern und Betreuer*innen die emotionale Entwicklung von Kindern fördern können. Als Praxisbeispiel wird das Gefühlstagebuch "Ein gutes Gefühl" vorgestellt. Kapitel 3.3 enthält kritische Anmerkungen zum Thema Achtsamkeit und Emotion.
Schlüsselwörter
Emotionale Entwicklung, primäre Emotionen, sekundäre Emotionen, emotionale Kompetenz, Erziehung, Gefühlstagebuch, Achtsamkeit, soziale Kompetenz, Kinderentwicklung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Emotionale Entwicklung vom Säuglings- bis zum Vorschulalter, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1245222