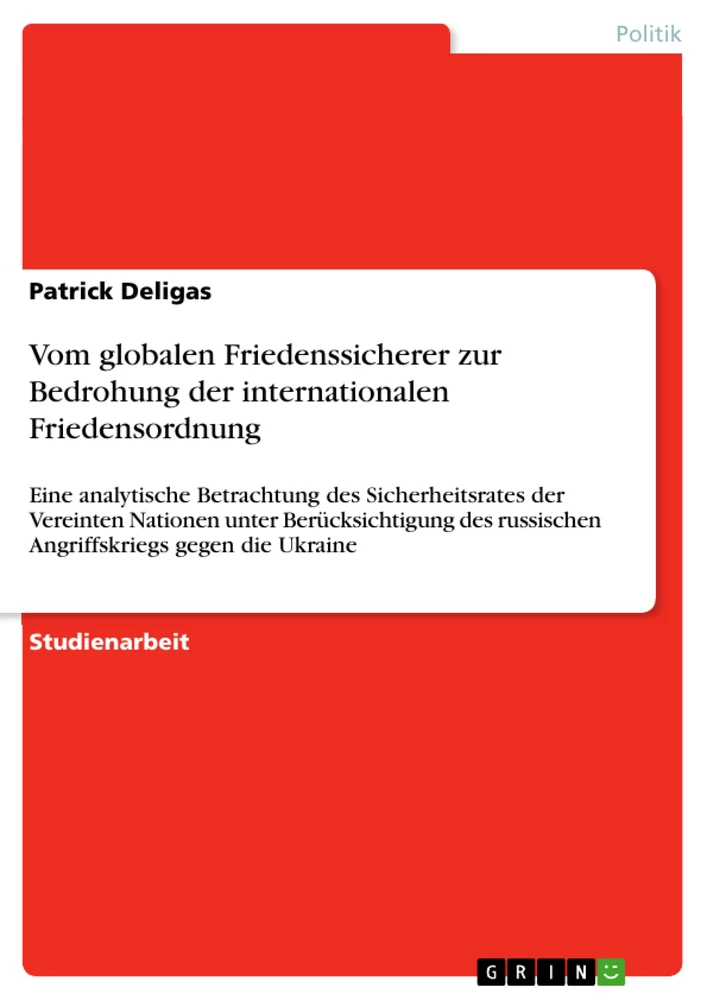Diese Arbeit setzt sich vorwiegend mit dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, als dem zentralen Instrument zur globalen Friedenssicherung auseinander. Und wird sich hierbei von der Frage leiten lassen, ob dieser den ihm von der Staatengemeinschaft übertragenen Aufgaben wirkungsvoll nachkommt.
Hierbei wird auf die Struktur, den Charakter und das Aufgabenspektrum des Gremiums eingegangen. Ebenso betrachtet werden die Legitimität und Autorität, mit denen der Sicherheitsrat ausgestattet wurde, und zu welchem Global Governance-Bereich sich dieser zuordnen lässt. Im Anschluss an diese grundlegenden Ausführungen erfolgt eine Bewertung, wie erfolgreich der Sicherheitsrat die ihm übertragenen Aufgaben erreicht. Herangezogen wird hierfür der seit 24. Februar 2022 andauernde russische militärische Invasion in der Ukraine.
Die am 24. Februar 2022 begonnene russische Invasion der Ukraine stellt eine Zeitenwende in der europäischen und internationalen Sicherheitsarchitektur nach dem Zweiten Weltkrieg und ebenso im politikwissenschaftlichen Forschungsgegenstand der Global Governance dar. Die Doomsday Clock, auch Weltuntergangsuhr genannt, steht bereits seit Januar 2020 bei 100 Sekunden vor Mitternacht und symbolisiert damit, wie nahe die Menschheit der Zerstörung ihrer Lebensgrundlage und Existenz ist – nie war die Menschheit diesem Ereignis näher.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Global Governance der Vereinten Nationen
- Die Vereinten Nationen
- Struktur des Sicherheitsrates
- Blockierter Friedenssicherer, neuer Qualität?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (VN) in der globalen Friedensordnung und beleuchtet insbesondere die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf dessen Legitimität und Wirksamkeit. Es wird analysiert, ob der Sicherheitsrat seinen Aufgaben zur Bewahrung des globalen Friedens gerecht wird und inwiefern er sich als Instrument der Global Governance eignet.
- Struktur und Aufgaben des Sicherheitsrates
- Legitimität und Autorität des Sicherheitsrates
- Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine als Herausforderung für die globale Friedensordnung
- Die Rolle des Sicherheitsrates im Kontext des russischen Angriffskriegs
- Zukünftige Herausforderungen für den Sicherheitsrat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt den aktuellen Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dar und betont dessen Bedeutung für die internationale Friedensordnung und die Global Governance. Das Kapitel „Global Governance der Vereinten Nationen“ definiert den Begriff Global Governance und stellt die Struktur und Funktionsweise der VN sowie des Sicherheitsrates vor. Das Kapitel „Blockierter Friedenssicherer, neuer Qualität?“ analysiert die Herausforderungen, die sich durch den russischen Angriffskrieg für den Sicherheitsrat ergeben, und diskutiert seine Rolle als Instrument der globalen Friedenssicherung.
Schlüsselwörter
Sicherheitsrat, Vereinte Nationen, Global Governance, Friedenssicherung, russischer Angriffskrieg, Ukraine, internationale Friedensordnung, Legitimität, Autorität, Völkerrecht, UN-Charta.
- Arbeit zitieren
- Patrick Deligas (Autor:in), 2022, Vom globalen Friedenssicherer zur Bedrohung der internationalen Friedensordnung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1244692