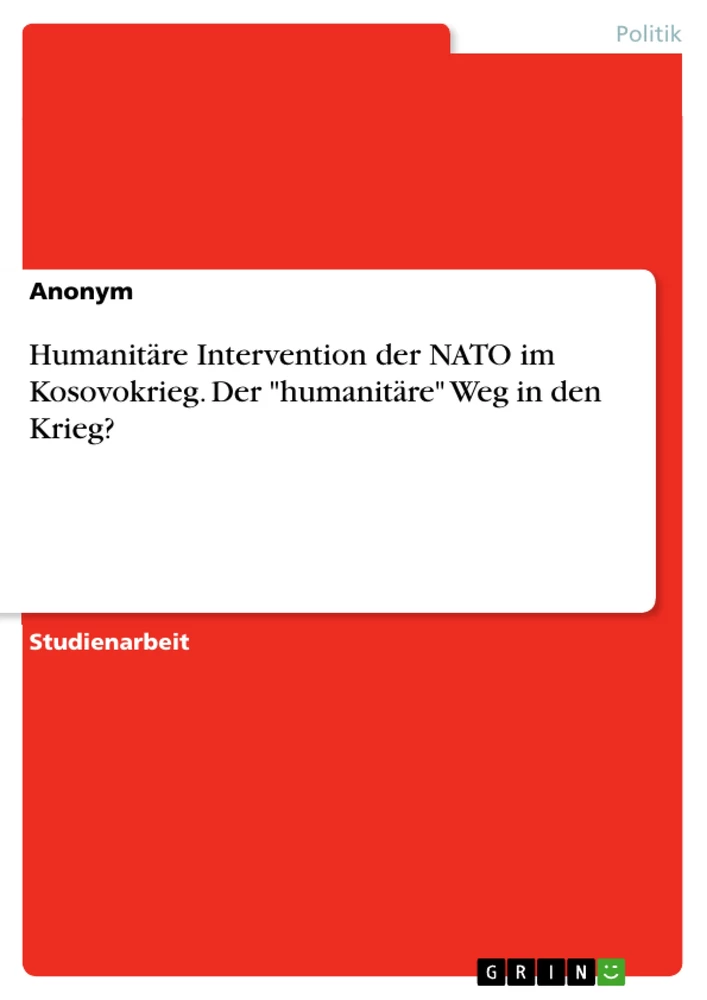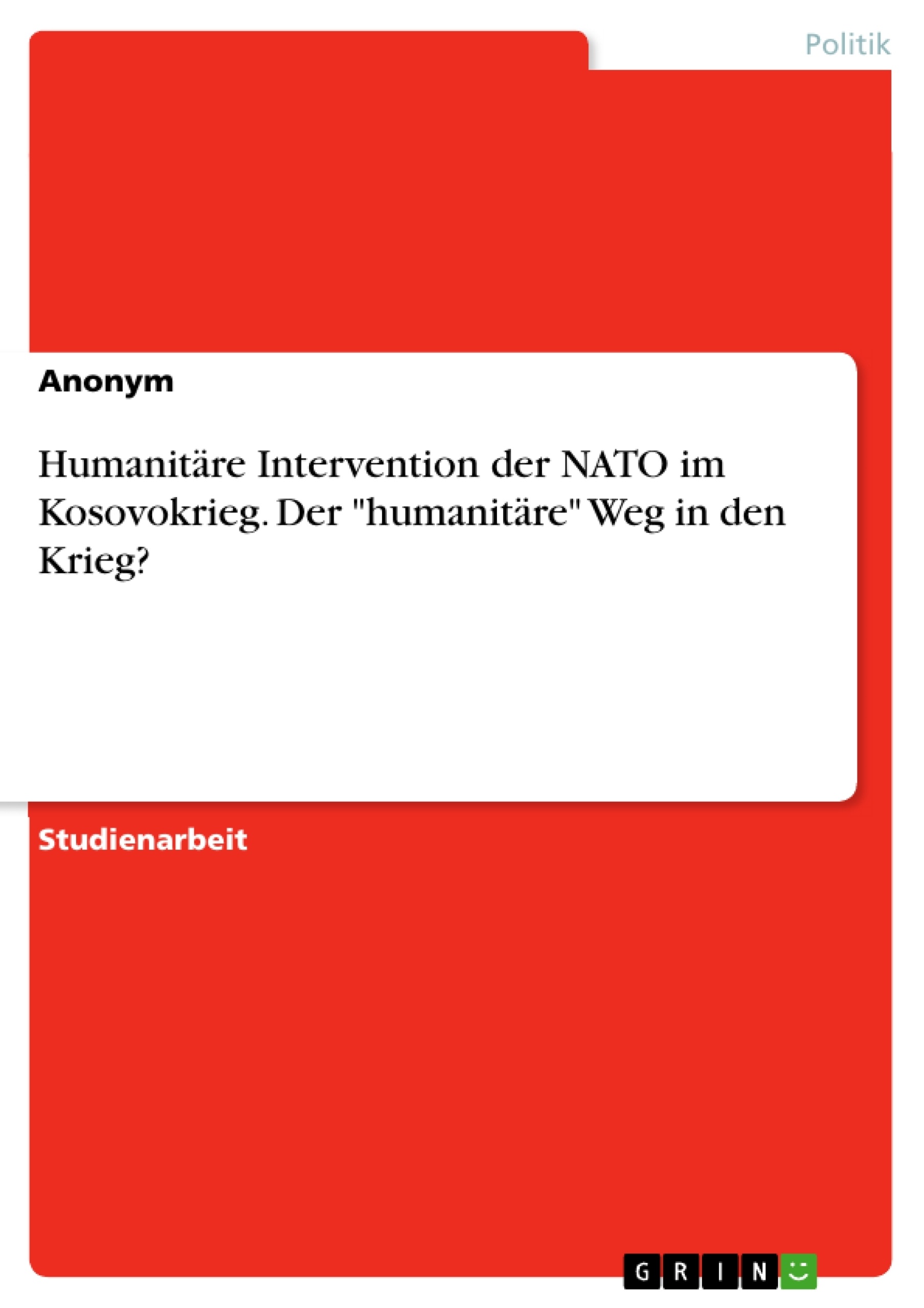Die Arbeit thematisiert die humanitäre Intervention der NATO im Kosovokrieg, so auch die Frage danach, inwiefern diese als humanitär einzustufen ist.
Das erste Kapitel handelt von einer theoretischen Grundlage der humanitären Interventionen mit der Definition des Begriffes sowie der Einordnung im internationalen Völkerrecht. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Kontextualisierung der völkerrechtlichen Diskurse sowie eine anschließende Auseinandersetzung mit dem Interventionsdilemma der UN vor dem Hintergrund der Völkermorde in Srebrenica und Ruanda, welche die Haltung der westlichen Mächte auf humanitären Interventionen, vor der Intervention im Kosovokrieg, veranschaulichen.
Das dritte Kapitel handelt von der humanitären Intervention im Kosovokrieg im Jahre 1999. Zunächst folgt eine Thematisierung des Kosovo-Konflikts sowie der Bestimmungsgründe dieses Konflikts, um zu verdeutlichen, inwiefern ein Eingreifen der westlichen Mächte nur eine Frage der Zeit war. Darauf aufbauend wird die Operation Allied Force der NATO sowie ihre Legitimationsgründen thematisiert. Anschließend folgt eine Auseinandersetzung mit den tatsächlichen humanitären Gegebenheiten NATO-Intervention.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die ,,humanitäre Intervention“
- Definition des Begriffes
- Legitimationsgrundlage im internationalen Völkerrecht?
- Interventionsdilemma: Das Versagen der UN in Ruanda und Srebrenica
- Die Humanitäre Intervention im Kosovo-Krieg
- Der Kosovo-Konflikt
- Operation Allied Force
- Der humanitäre Krieg?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der humanitären Intervention der NATO im Kosovo-Krieg und untersucht, inwiefern diese als humanitär einzustufen ist. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen der humanitären Interventionen, beleuchtet die völkerrechtlichen Diskurse und setzt sich mit dem Interventionsdilemma der UN auseinander, bevor sie sich auf die spezifischen Aspekte der Intervention im Kosovo konzentriert.
- Definition und Einordnung der Humanitären Intervention im internationalen Völkerrecht
- Das Interventionsdilemma der UN in Ruanda und Srebrenica
- Die Operation Allied Force der NATO im Kosovo-Krieg
- Die Legitimität und die humanitären Gegebenheiten der NATO-Intervention
- Die ethische und völkerrechtliche Problematik von humanitären Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs ,,Humanitäre Intervention“ und untersucht die völkerrechtliche Legitimation dieses Konzeptes. Dabei wird auch auf die Rolle der UN und das Interventionsdilemma, das sich in den Geschehnissen in Ruanda und Srebrenica zeigte, eingegangen. Das zweite Kapitel behandelt den Kosovo-Krieg und analysiert die Hintergründe des Konflikts, sowie die Operation Allied Force der NATO, die als humanitäre Intervention dargestellt wurde. Dieses Kapitel beleuchtet auch die Legitimationsgründe und die tatsächlichen humanitären Gegebenheiten der NATO-Intervention.
Schlüsselwörter
Humanitäre Intervention, Völkerrecht, Interventionsdilemma, Kosovo-Krieg, Operation Allied Force, NATO, Legitimität, Menschenrechte, Souveränität, UN-Charta.
Häufig gestellte Fragen
War die NATO-Intervention im Kosovo völkerrechtlich legitimiert?
Dies ist umstritten. Die Arbeit beleuchtet das Spannungsfeld zwischen staatlicher Souveränität und dem Schutz der Menschenrechte ohne UN-Mandat.
Was war das "Interventionsdilemma" der UN?
Das Versagen der Weltgemeinschaft in Ruanda und Srebrenica prägte die Überzeugung, dass bei Völkermord ein militärisches Eingreifen moralisch notwendig sei.
Was verbirgt sich hinter dem Namen "Operation Allied Force"?
Es war der offizielle Name der NATO-Luftangriffe gegen die Bundesrepublik Jugoslawien im Jahr 1999.
Wie wird eine "humanitäre Intervention" definiert?
Als Anwendung militärischer Gewalt durch einen Staat oder eine Organisation, um massive Menschenrechtsverletzungen in einem anderen Staat zu beenden.
Welche Rolle spielt die UN-Charta in diesem Diskurs?
Die UN-Charta verbietet grundsätzlich Gewalt gegen andere Staaten, was die Legitimität eigenmächtiger NATO-Einsätze in Frage stellt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Humanitäre Intervention der NATO im Kosovokrieg. Der "humanitäre" Weg in den Krieg?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1244462