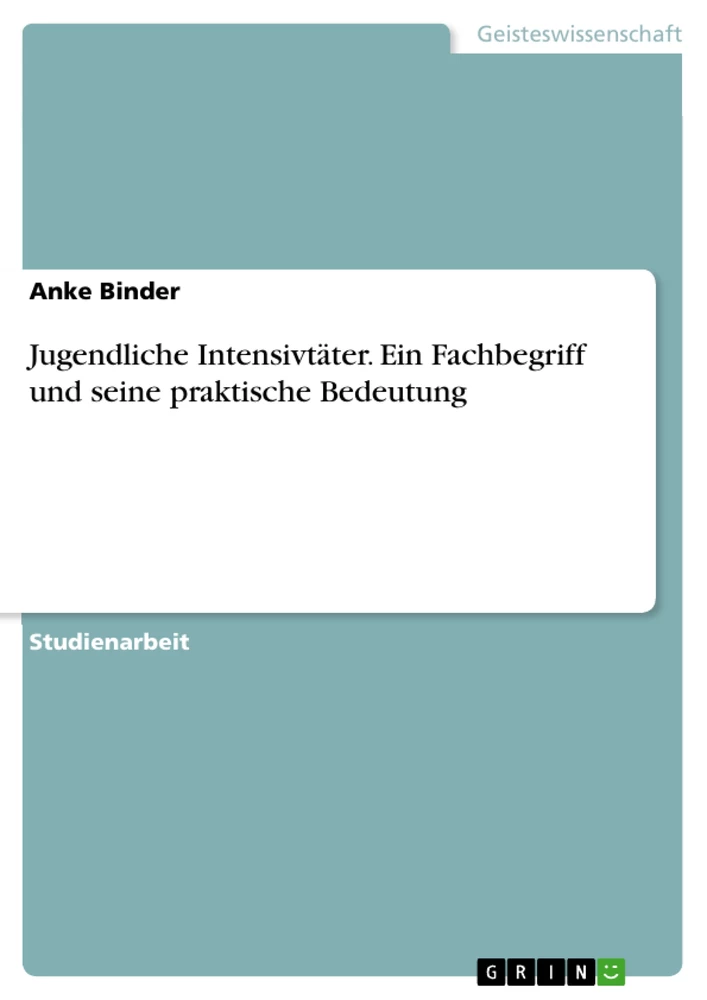Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff der jugendlichen „Intensivtäter“.
Es wird erläutert, welche Gruppe von Tätern damit überhaupt gemeint ist und woher der Begriff beziehungsweise seine Definitionen stammen. Es folgt eine Problematisierung des Begriffs, die vor allem seine Zweckmäßigkeit infrage stellt.
Im Anschluss wird erörtert, wie dem Phänomen präventiv entgegengewirkt werden kann und wie Soziale Arbeit und Justiz mit „Intensivtätern“ verfahren könnten, beziehungsweise es tun. Besonders die Rolle von Akteuren der sozialen Arbeit wird hierbei beleuchtet.
Junge Menschen, in aller Regel männlich, die viele, besonders rücksichtslose und brutale Straftaten begehen, häufig Mitglieder sogenannter „Clans“, meist mit Migrationshintergrund aus Nordafrika oder dem Nahen Osten. Das Bild, das gezeichnet wird, ist deutlich: Diese jungen Menschen sind für die Gesellschaft verloren, haben ihre „kriminelle Karriere“ schon als Kind begonnen und kennen kein gesellschaftskonformes Verhalten.
Gleichzeitig wird, zumindest in der Boulevardpresse, der Begriff „Intensivtäter“ meist nicht weiter erklärt. Offenbar geht man davon aus, die Leserschaft wüsste schon Bescheid, wer diese „Intensivtäter“ sind.
In dieser Arbeit soll nun herausgearbeitet werden, welches Phänomen hinter dem Begriff jugendliche „Intensivtäter“ steckt. Wen bezeichnet der Begriff? Wer sind diese jungen Leute, was tun sie – und vor allem: Wie kann die Gesellschaft und insbesondere die Soziale Arbeit diesem Phänomen entgegenwirken?
Dazu soll zuerst einmal das zugrundeliegende Feld der Jugendkriminalität beleuchtet werden, um herauszustellen, worin sich diese „besonderen“ Täter von den anderen unterscheiden. Im Folgenden sollen Begrifflichkeiten und ihre Problematik sowie die soziodemografischen Merkmale der Gruppe „Intensivtäter“ untersucht werden, um anschließend Ansatzpunkte für den Umgang mit diesen und die Prävention herauszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugendkriminalität
- Intensivtäter
- Die Gruppe der „Intensivtäter“
- Der Begriff „Intensivtäter“
- Problematik des Begriffes
- Persistenz und Abbruch
- Umgang mit „Intensivtätern“
- Abbrüche fördern
- Frühe Prävention
- Strafrechtliche Maßnahmen
- Intensivtäterprogramme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Begriff der jugendlichen „Intensivtäter“. Es werden die Gruppe der jugendlichen Intensivtäter, die Herkunft des Begriffs und seine Definitionen erläutert. Anschließend wird die Zweckmäßigkeit des Begriffs hinterfragt und eingeführt, wie dem Phänomen präventiv entgegengewirkt werden kann.
- Erläuterung der Gruppe der „Intensivtäter“
- Analyse der Herkunft und Definition des Begriffs „Intensivtäter“
- Bewertung der Zweckmäßigkeit des Begriffs „Intensivtäter“
- Untersuchung von Präventionsmaßnahmen gegen die Delinquenz von Jugendlichen
- Diskussion des Umgangs von Sozialer Arbeit und Justiz mit „Intensivtätern“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die mediale Darstellung von „Intensivtätern“ und stellt die unterschiedlichen Definitionen des Begriffs in verschiedenen Bundesländern dar. Kapitel 1 betrachtet das allgemeine Feld der Jugendkriminalität, um die spezifischen Eigenschaften von „Intensivtätern“ hervorzuheben.
Kapitel 2 widmet sich dem Begriff „Intensivtäter“. Es werden die Gruppe der „Intensivtäter“ vorgestellt, der Begriff selbst analysiert und seine Problematik kritisch beleuchtet. Des Weiteren werden die Themen Persistenz und Abbruch von Delinquenz erörtert.
In Kapitel 3 wird der Umgang mit „Intensivtätern“ durch verschiedene Akteure diskutiert, wobei insbesondere die Rolle der Sozialen Arbeit im Fokus steht. Hierbei werden die Förderung von Abbrüchen von kriminellen Verhaltensweisen, frühe Präventionsmaßnahmen, strafrechtliche Maßnahmen und Intensivtäterprogramme beleuchtet.
Schlüsselwörter
Jugendkriminalität, Intensivtäter, Delinquenz, Prävention, Soziale Arbeit, Jugendhilfe, Strafrecht, Justiz, Stigmatisierung, Problematik des Begriffs, Persistenz, Abbruch.
- Arbeit zitieren
- Anke Binder (Autor:in), 2019, Jugendliche Intensivtäter. Ein Fachbegriff und seine praktische Bedeutung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1243250