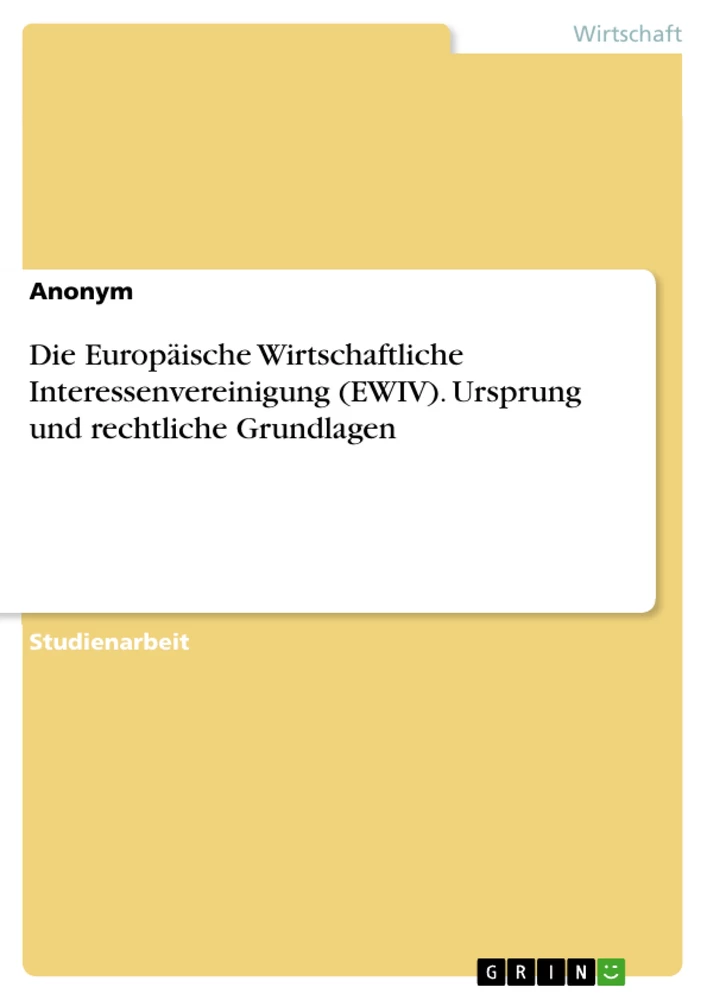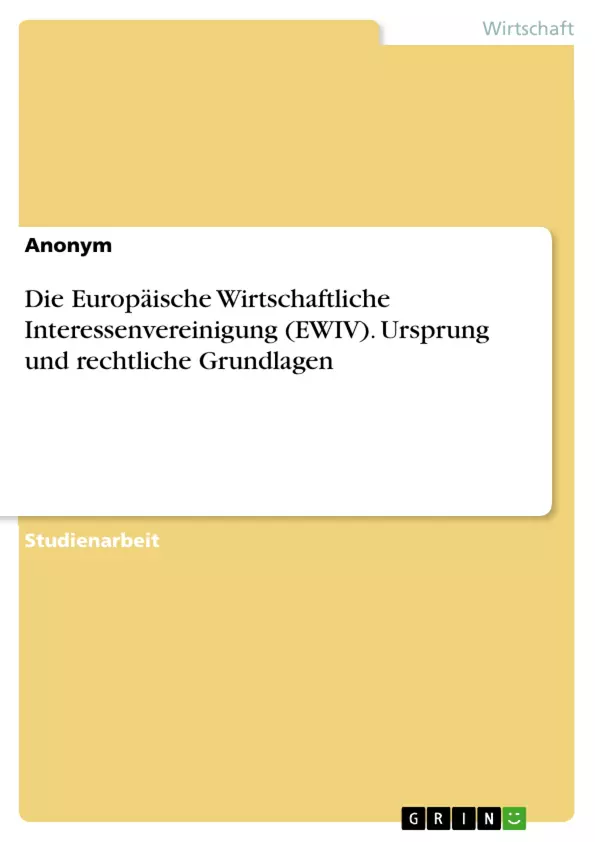In dieser Arbeit sollen die geschichtliche Entwicklung und der Ursprung der EWIV und ihre rechtlichen Grundlagen kurz aufgezeigt werden.
Am 25.7.1999 beschloss der EG-Ministerrat die Verordnung Nr. 2137/85. Damit war die Grundlage für die Schaffung der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) gelegt. Mit der Schaffung dieser Rechtsform betrat der europäische Normgeber erstmals juristisches "Neuland": Nach Artikel 2 EWGV ist Aufgabe der europäischen Gemeinschaft, einen "Gemeinsamen Markt" zu errichten und die Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten einander anzunähern. Das Funktionieren dieses Marktes setzt voraus, dass die Marktteilnehmer ohne große rechtliche Hindernisse grenzüberschreitend tätig werden können. Erforderlich ist somit die Schaffung eines einheitlichen rechtlichen Rahmens auf dem Gebiet des Gemeinsamen Marktes.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt und Gliederung
- A. Einleitung
- B. Entstehungsgeschichte der EWIV
- C. Die rechtlichen Grundlagen der EWIV
- I. Die Verordnung 2137/85
- 1. Verordnung oder Richtlinie?
- 2. Rechtsgrundlage der Verordnung
- II. Die Verknüpfung mit nationalem Recht
- 1. Vorgaben durch die Verordnung
- 2. Das deutsche Ausführungsgesetz
- 3. Normhierachie
- D. Das Gesellschaftsrecht der EWIV
- I. Die Rechtsnatur der EWIV
- II. Zweck der EWIV
- 1. Allgemeine Zweckbestimmung
- 2. Besondere Zweckbestimmungsverbote
- 3. Einordnung in das deutsche Gesellschaftsrecht
- III. Mitglieder der EWIV
- IV. Gründung der EWIV
- 1. Der Gründungsvertrag
- 2. Die Registereintragung
- 3. Hinterlegung und Bekanntmachung
- 4. Rechtslage vor Eintragung
- 5. Sitz der Vereinigung und deren Verlegung
- V. Das Innenrecht der EWIV
- 1. Binnenorganisation
- 2. Rechte und Pflichten der Mitglieder
- a) Rechte der Mitglieder
- b) Pflichten der Mitglieder
- VI. Das Außenrecht der EWIV
- 1. Die Vertretung der Vereinigung
- 2. Die Haftung für Verbindlichkeiten der EWIV
- VII. Wechsel in der Mitgliedschaft
- 1. Ausscheiden eines Mitglieds
- 2. Eintritt in eine EWIV
- 3. Abtretung und Verpfändung der Mitgliedschaft
- VIII. Nichtigkeit, Auflösung, Liquidation und Insolvenz
- E. Die Besteuerung der EWIV
- F. Die EWIV in der Praxis
- I. Verwendungsmöglichkeiten der EWIV
- 1. Allgemeine Verwendungsmöglichkeiten
- 2. Insbesondere: Die Rechtsanwalts-EWIV
- II. Akzeptanz der EWIV
- G. Würdigung und Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) als eine innovative Gesellschaftsform innerhalb der Europäischen Union. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen, die Entstehung und die praktische Anwendung der EWIV. Das Hauptziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der EWIV zu vermitteln, ihre Bedeutung im europäischen Wirtschaftsraum zu beleuchten und ihre Chancen und Herausforderungen in der Praxis zu analysieren.
- Rechtliche Grundlagen der EWIV
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung der EWIV
- Gesellschaftsrechtliche Aspekte der EWIV
- Praktische Verwendungsmöglichkeiten der EWIV
- Akzeptanz und Bedeutung der EWIV in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A: Einleitung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die EWIV und ihre Relevanz im Kontext des europäischen Wirtschaftsraums.
- Kapitel B: Entstehungsgeschichte der EWIV: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der EWIV und die Beweggründe für ihre Einführung als gesellschaftsrechtliche Form.
- Kapitel C: Die rechtlichen Grundlagen der EWIV: In diesem Kapitel werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der EWIV, insbesondere die Verordnung 2137/85, sowie die Verknüpfung mit nationalem Recht analysiert.
- Kapitel D: Das Gesellschaftsrecht der EWIV: Dieses Kapitel behandelt die Rechtsnatur der EWIV, ihre Zweckbestimmung, die Mitgliederstruktur und die Gründungsprozesse.
- Kapitel E: Die Besteuerung der EWIV: Dieses Kapitel beleuchtet die steuerlichen Besonderheiten der EWIV und die relevanten steuerlichen Regelungen.
- Kapitel F: Die EWIV in der Praxis: Dieses Kapitel untersucht die Verwendungsmöglichkeiten der EWIV in der Praxis, ihre Akzeptanz und die Herausforderungen, die bei ihrer Nutzung auftreten können.
Schlüsselwörter
Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV), Gesellschaftsform, europäisches Recht, Gesellschaftsrecht, Verordnung 2137/85, Gründung, Mitgliedschaft, Rechtsnatur, Zweckbestimmung, Besteuerung, praktische Anwendung, Akzeptanz, Herausforderungen, Chancen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV). Ursprung und rechtliche Grundlagen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1243106