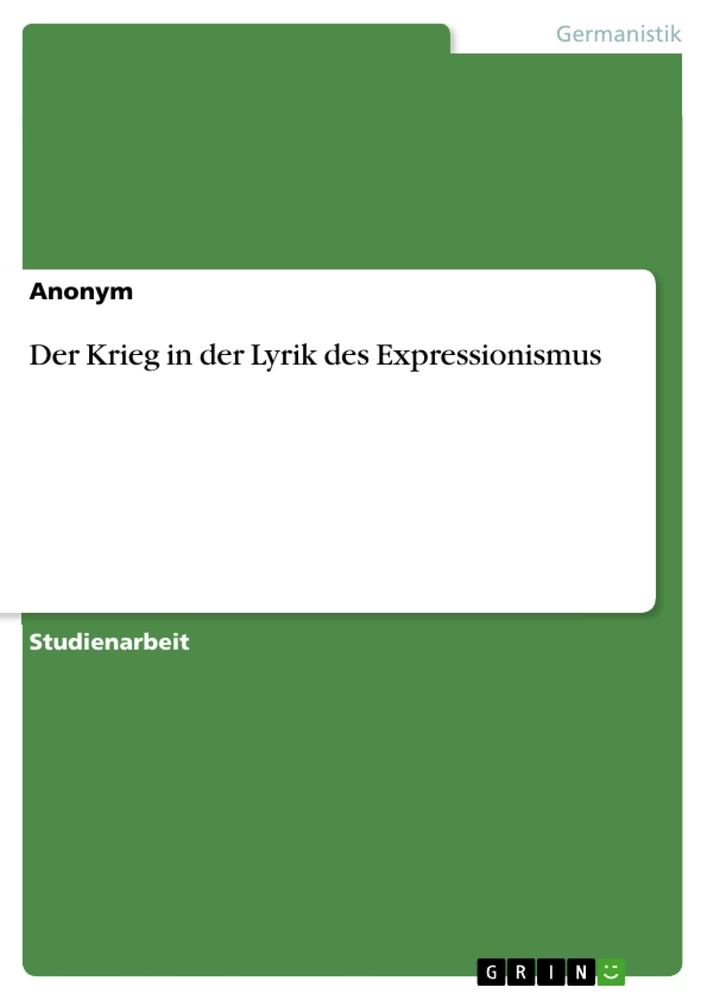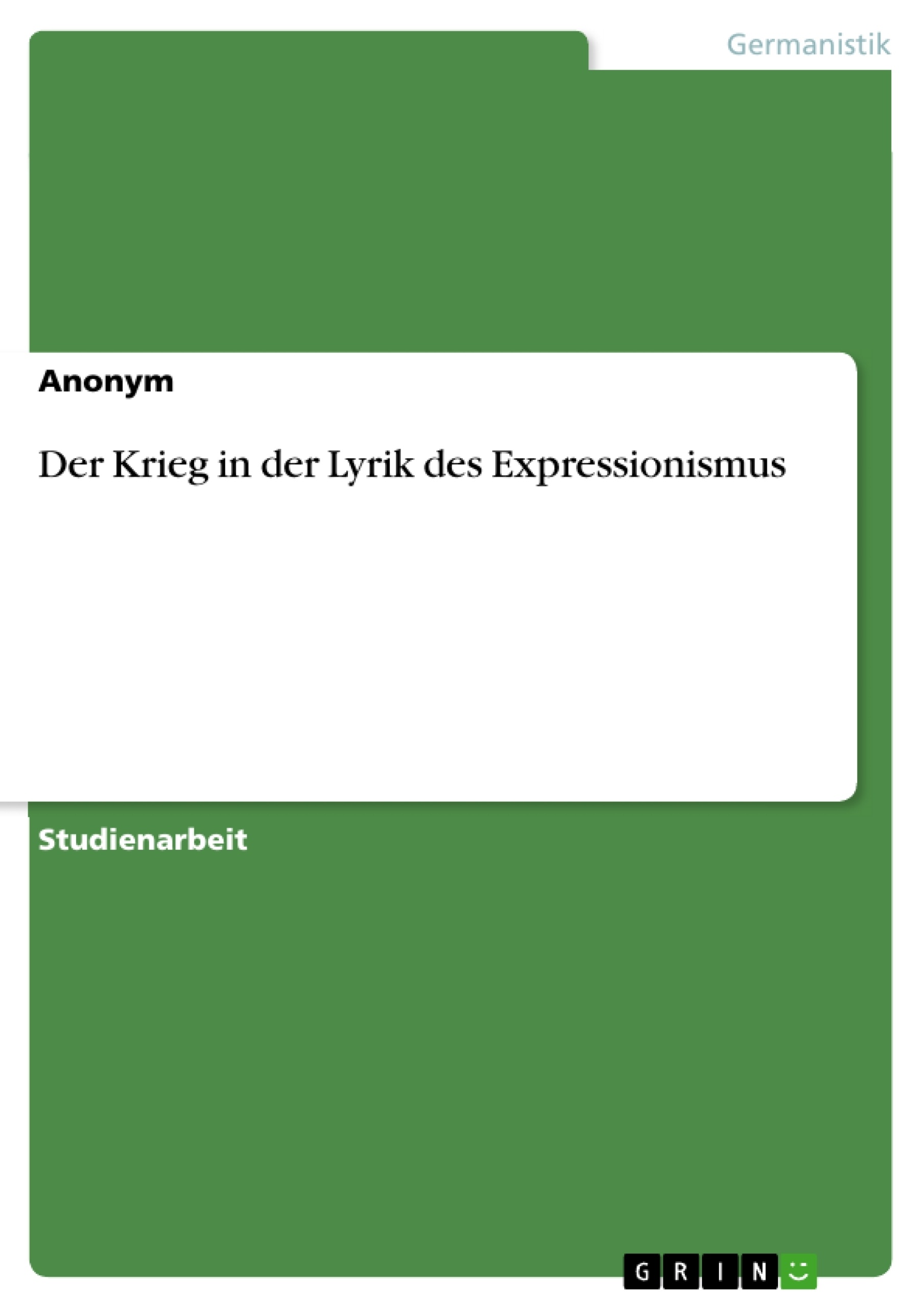Ich werde in meiner Hausarbeit mehr auf die Darstellung des Krieges in der Lyrik des Expressionismus eingehen und das Gedicht von Georg Heym "Der Krieg" mit dem Gedicht von Georg Trakl "Grodek" in Bezug auf die Darstellung des Krieges vergleichen.
Obwohl literarische Epochen eher fließende Übergänge besitzen, haben sich verschiedene Literaturwissenschaftler auf die Zeitspanne zwischen 1910-1920 als expressionistisches Jahrzehnt geeinigt. In dieser Zeit spielte der erste Weltkrieg eine wichtige Rolle in der Lyrik. Er stellte eine Zäsur für die Begriffe Tenor und Topos in der expressionistischen Lyrik dar. Der Krieg war für viele Autoren die Kraft, die die überkömmliche bürgerliche Gesellschaft hinwegfegt und erneuert, weshalb er auch herbeigesehnt wurde. Allerdings änderte sich das Kriegsbild vieler Dichter, als diese, eigene Erfahrungen an der Front machten und das Ausmaß der Vernichtung miterlebten.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Georg Heym:Der Krieg
Georg Trakl:Grodek
Der Vergleich –Der Krie vs.Grodek
Fazit
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Der Krieg in der Lyrik des Expressionismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1243094