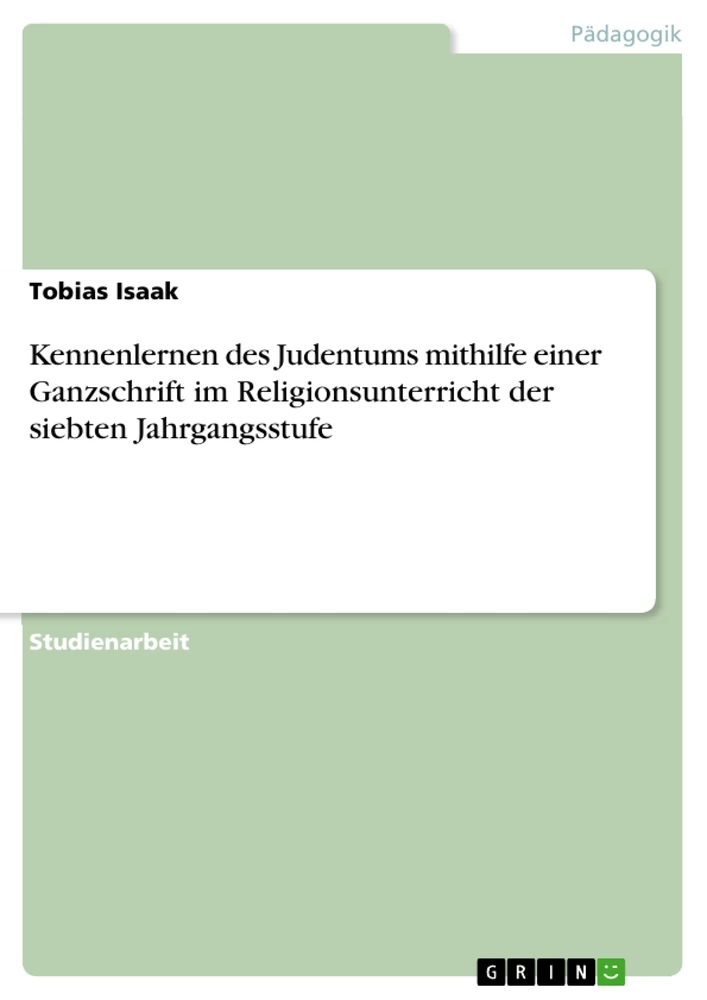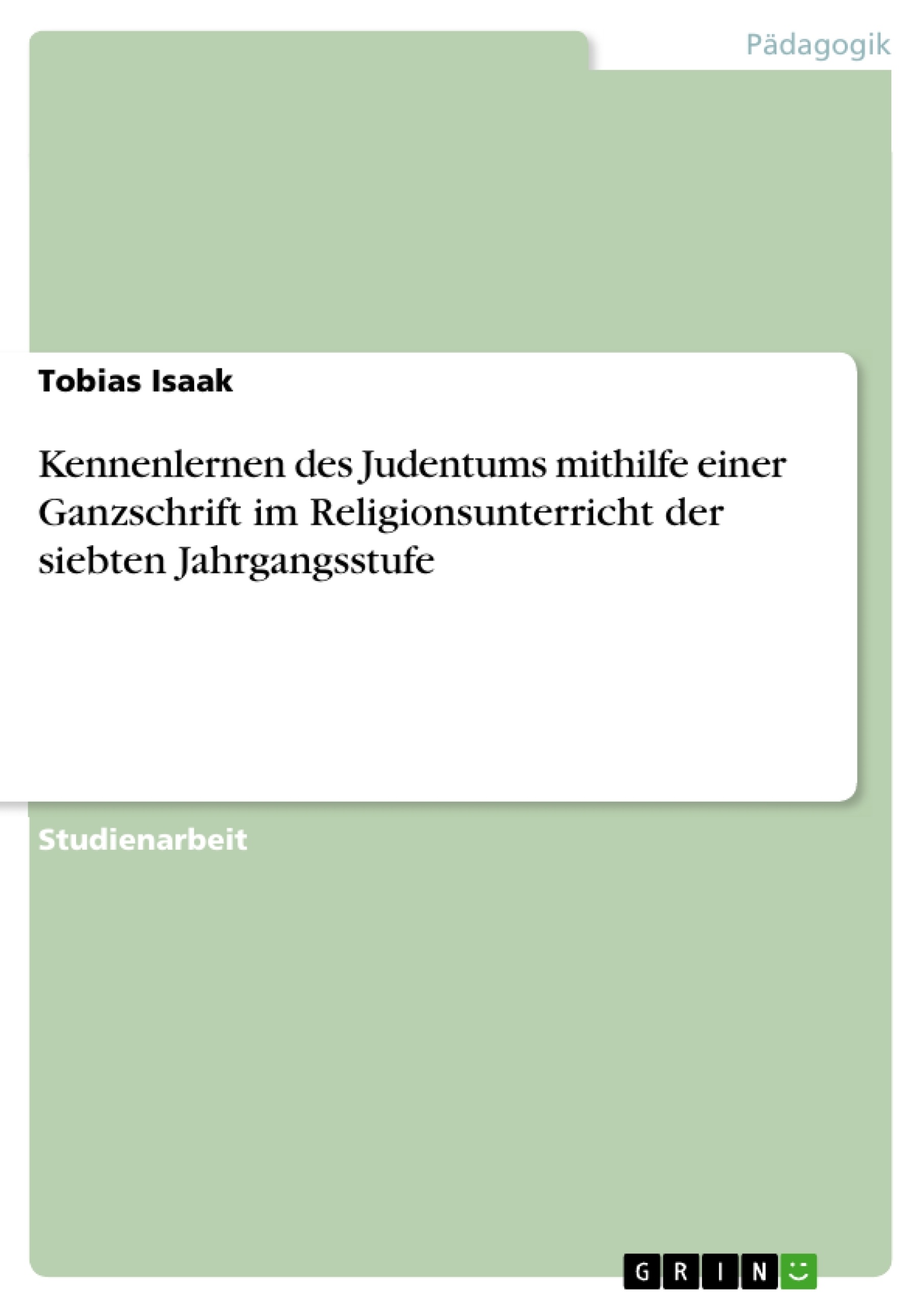Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Kennenlernen des Judentums mithilfe einer Ganzschrift im konfessionell-kooperativen Religionsunterricht der siebten Jahrgangsstufe.
Die Vermittlung jüdischer Geschichte, Religion und Kultur in der Schule ist ein klarer Auftrag des Kultusministeriums an das Schulwesen der Bundesrepublik. Auch wenn die Organisationsformen der Fächer, insbesondere des Religionsunterrichts, aufgrund der föderalen Ordnung der Bundesrepublik in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet sind, ist die fächerübergreifende Thematisierung des Judentums in allen Lehrplänen fest verankert.
Das Judentum stellt als eine der großen Weltreligionen nur eine von vielen religiösen Anschauungen und Praktiken dar, denen man heute in Deutschland begegnet. In dieser Vielfalt brauchen gerade junge Menschen Orientierung. In der Schule werden die Fragen und Phänomene, die sich aus der Begegnung der Schüler*innen mit religiöser Vielfalt ergeben, durch interreligiöses Lernen im Religionsunterricht aufgenommen. Unabhängig von der jeweiligen Form des Religionsunterrichts wird die Absicht verfolgt, die Verständigung und die Dialogfähigkeit zwischen Menschen unterschiedlichen Glaubens zu fördern.
Von Seiten der Religionsdidaktik gibt es verschiedene konzeptionelle Ansätze, die angestrebten interreligiösen Kompetenzen zu beschreiben. Dazu ist zu erwähnen, dass es sich bei diesen Ansätzen um christliche Perspektiven katholischer und evangelischer Theolog*innen zu interreligiösem Lernen handelt. Aus anderen Religionen, wie zum Beispiel dem Judentum und dem Islam gibt es bisher keine größeren Darstellungen zu diesem Thema.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Rahmen
- 2.1 Thema Judentum und interreligiöse Kompetenz
- 2.2 Ganzschriften
- 2.2.1 Einordnung des Jugendromans “Damals war es Friedrich”
- 3 Forschungsdesign
- 3.1 Stichprobenauswahl
- 3.2 Erhebungsverfahren
- 3.3 Erhebungsinstrument
- 3.4 Durchführung
- 3.5 Auswertungsverfahren
- 4 Ergebnisse
- 5 Diskussion und Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie analysiert die Darstellung des Judentums im Religionsunterricht der siebten Jahrgangsstufe anhand einer konkreten Unterrichtsreihe. Im Fokus steht die Frage, inwieweit eine ausschließlich vergangenheitsorientierte Ganzschrift, nämlich der Jugendroman "Damals war es Friedrich" von Hans Peter Richter, zu einer einseitigen und undifferenzierten Wahrnehmung des Judentums führen kann. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen dieser literarischen Quelle auf die Entwicklung interreligiöser Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern.
- Das Thema Judentum im Religionsunterricht und die Bedeutung interreligiöser Kompetenz
- Der Einsatz von Ganzschriften im Religionsunterricht und deren Auswirkungen auf die Darstellung des Judentums
- Die Balance zwischen Vergangenheit und Gegenwart in der Vermittlung jüdischer Geschichte, Religion und Kultur
- Die Relevanz einer zukunftsorientierten und authentischen Darstellung des Judentums
- Der Einfluss von Medien auf die Wahrnehmung und das Verständnis von Religion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz einer ausgewogenen Darstellung des Judentums im Schulunterricht und kritisiert die Tendenz, das Judentum auf die Vergangenheit und den Holocaust zu reduzieren. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, wie eine Balance zwischen Vergangenheit und Gegenwart im Religionsunterricht erreicht werden kann. Im theoretischen Rahmen werden verschiedene Ansätze zu interreligiöser Kompetenz im Religionsunterricht vorgestellt, wobei der Fokus auf die Bedeutung der Auseinandersetzung mit anderen Glaubensweisen und Weltanschauungen liegt.
Das Forschungsdesign beschreibt die Methodik der Studie, die sich auf die Analyse einer konkreten Unterrichtsreihe zum Thema Judentum konzentriert. Die Untersuchung befasst sich mit der Stichprobenauswahl, den Erhebungsverfahren, dem Erhebungsinstrument, der Durchführung und der Auswertung der Daten.
Schlüsselwörter
Judentum, Religionsunterricht, interreligiöse Kompetenz, Ganzschrift, Jugendroman, "Damals war es Friedrich", Holocaust, Vergangenheit, Gegenwart, Authentizität, Schulbuch, Medien, Unterrichtsreihe, Analyse.
- Arbeit zitieren
- Tobias Isaak (Autor:in), 2020, Kennenlernen des Judentums mithilfe einer Ganzschrift im Religionsunterricht der siebten Jahrgangsstufe, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1242732