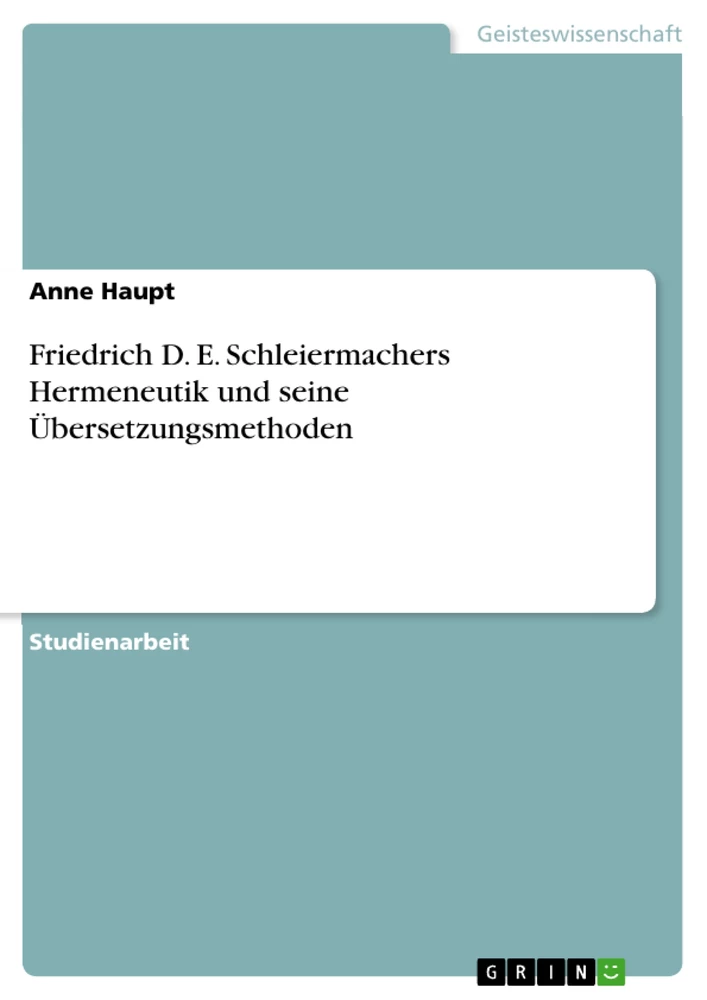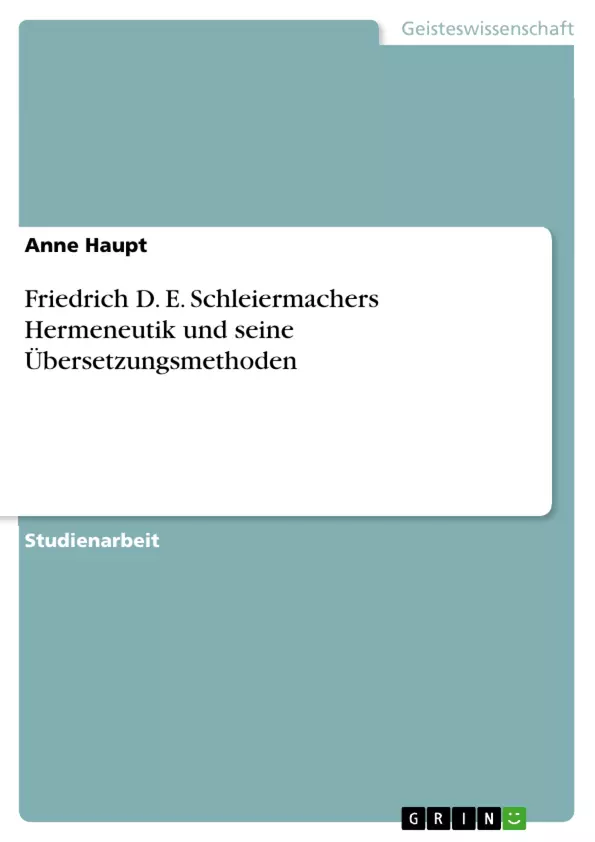Da das Verstehen fremdsprachlicher Texte als eine Kunst interpretiert werden kann, sollen in dieser Arbeit besonders Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers Übersetzungsarbeiten im Zusammenhang mit seiner hermeneutischen Auffassung untersucht werden. Wie bedienen sich seine Übersetzungsmethoden eines hermeneutischen Hintergrunds und wieso werden sie diesem nur bedingt gerecht? Dazu soll Schleiermachers Hermeneutikbegriff komprimiert dargestellt werden, um die Wichtigkeit der Sprache und ihrer Interpretation zu unterstreichen.
Daraufhin werden die Übersetzungsmethoden wiedergegeben und ihre Schwierigkeiten für den Übersetzer verdeutlicht. So soll die Verbindung zwischen Schleiermachers Hermeneutik und seiner Übersetzungstheorie deutlich werden. Hermeneutik wird weitverbreitet als die Kunst der Auslegung, der Interpretation und als Theorie dieser Auslegung, also die Reflexion der Bedingungen des Verstehens und dieser sprachlichen Wiedergabe, verstanden. Schleiermacher hat sich als Theologe, Philosoph, Pädagoge und als Übersetzer der Texte Platons im 19. Jahrhundert etablieren können.
Nach seinem Theologie- und Philosophiestudium in Halle arbeitete er als Prediger und war später als Professor in Halle und Berlin tätig. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts begann er mit seinen ersten Übersetzungen von Predigten englischer Geistlicher und erst Friedrich Schlegel soll ihn beeinflusst haben gegeben haben, an einer Platon-Übersetzung teilzunehmen. Schleiermachers Hermeneutik beschränkt sich nicht nur auf geschriebene Worte, sondern auf Reden jeglicher Art und hat somit nicht nur einen klassisch-theologischen, sondern auch einen alltäglichen soziokulturellen Charakter.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schleiermachers Hermeneutikbegriff
- 2.1 Sprache als Fundament
- 2.2 Die Arten der Interpretationen
- 3. Übersetzungsmethoden nach Schleiermacher
- 3.1 Das hermeneutische Problem der Übersetzungsmethode
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Friedrich Schleiermachers Hermeneutik und deren Einfluss auf seine Übersetzungsmethoden. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen seinem hermeneutischen Verständnis und seiner praktischen Übersetzungstätigkeit aufzuzeigen und zu analysieren, inwieweit seine Methoden seinem eigenen hermeneutischen Ansatz gerecht werden.
- Schleiermachers Hermeneutikbegriff und dessen Grundlagen
- Die Rolle der Sprache in Schleiermachers Hermeneutik
- Schleiermachers Übersetzungsmethoden und ihre Herausforderungen
- Der Zusammenhang zwischen Hermeneutik und Übersetzung bei Schleiermacher
- Analyse der Anwendung hermeneutischer Prinzipien in der Übersetzungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis zwischen Schleiermachers Hermeneutik und seinen Übersetzungsmethoden. Sie skizziert den historischen Kontext, Schleiermachers Wirken als Theologe, Philosoph und Übersetzer und hebt die Relevanz des Themas hervor, indem sie das Verstehen fremdsprachlicher Texte als eine Form der Interpretation darstellt. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an: eine komprimierte Darstellung von Schleiermachers Hermeneutikbegriff, gefolgt von der Analyse seiner Übersetzungsmethoden und der Herausforderungen, denen diese begegnen.
2. Schleiermachers Hermeneutikbegriff: Dieses Kapitel erörtert Schleiermachers Hermeneutik, ausgehend von seinem pädagogischen Ansatz und seinem Verständnis des Lebens als Wechselspiel von Aneignung und Abstoßung. Es wird der Einfluss seiner theologischen Ausbildung hervorgehoben und sein Verständnis der Religion als Interaktion zwischen dem Anschauenden und dem Angeschaueten erläutert. Die Bedeutung der Kommunikation und die Wechselwirkung zwischen Individuum und Gemeinschaft werden im Kontext seiner Ethik und seiner umfassenden Kulturtheorie beleuchtet. Schleiermachers Hermeneutik wird nicht nur als klassisch-theologische, sondern auch als soziokulturelle Theorie präsentiert.
2.1 Sprache als Fundament: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die fundamentale Rolle der Sprache in Schleiermachers Hermeneutik. Die Sprache wird als ein sich stetig entwickelnder Prozess verstanden, der Individuen ermöglicht, ihre Gedanken für die Gemeinschaft zugänglich zu machen. Das Kapitel betont das notwendige Zusammenspiel zwischen Rhetorik und Hermeneutik, wobei jeder Akt des Verstehens als Umkehrung eines Aktes des Redens beschrieben wird. Die Bedeutung des Sprachtalents und der Menschenkenntnis für die erfolgreiche Anwendung der Hermeneutik und Rhetorik wird herausgestellt, wobei "Sprachtalent" nicht nur das Erlernen neuer Sprachen, sondern den Sinn für Analogie und Differenz in der Sprache beschreibt.
3. Übersetzungsmethoden nach Schleiermacher: Dieses Kapitel analysiert Schleiermachers Übersetzungsmethoden im Kontext seiner hermeneutischen Theorie. Es untersucht, wie seine Übersetzungsansätze von seinem hermeneutischen Hintergrund geprägt sind und inwiefern sie diesem gerecht werden. Die Kapitel fokussieren auf die Herausforderungen, denen ein Übersetzer begegnet, und beleuchten das Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach originalgetreuer Wiedergabe und der Notwendigkeit einer adäquaten Verständlichkeit für den Zielgruppen.
3.1 Das hermeneutische Problem der Übersetzungsmethode: Dieser Abschnitt beleuchtet die spezifischen hermeneutischen Probleme, die im Übersetzungsprozess auftreten. Die Herausforderungen der Interpretation und der adäquaten Wiedergabe fremder Texte werden im Detail untersucht und mit Schleiermachers hermeneutischem Ansatz in Beziehung gesetzt. Der Abschnitt analysiert die Schwierigkeiten, die sich aus den unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Kontexten ergeben und wie Schleiermacher diese Herausforderungen in seiner Praxis angegangen ist.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Schleiermachers Hermeneutik und ihre Anwendung in der Übersetzung
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Friedrich Schleiermachers Hermeneutik und deren Einfluss auf seine Übersetzungsmethoden. Das Hauptziel ist es, den Zusammenhang zwischen seinem hermeneutischen Verständnis und seiner praktischen Übersetzungstätigkeit aufzuzeigen und zu analysieren, inwieweit seine Methoden seinem eigenen hermeneutischen Ansatz gerecht werden.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt Schleiermachers Hermeneutikbegriff und dessen Grundlagen, die Rolle der Sprache in seiner Hermeneutik, seine Übersetzungsmethoden und deren Herausforderungen, den Zusammenhang zwischen Hermeneutik und Übersetzung bei Schleiermacher und die Analyse der Anwendung hermeneutischer Prinzipien in der Übersetzungspraxis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz erläutert. Es folgt ein Kapitel über Schleiermachers Hermeneutik, unterteilt in einen Abschnitt über Sprache als Fundament. Ein weiteres Kapitel analysiert Schleiermachers Übersetzungsmethoden, inklusive eines Abschnitts über die spezifischen hermeneutischen Probleme der Übersetzung. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Rolle spielt die Sprache in Schleiermachers Hermeneutik?
Sprache ist für Schleiermacher fundamental. Sie wird als ein sich stetig entwickelnder Prozess verstanden, der Individuen ermöglicht, ihre Gedanken für die Gemeinschaft zugänglich zu machen. Das Zusammenspiel zwischen Rhetorik und Hermeneutik wird betont, wobei jeder Akt des Verstehens als Umkehrung eines Aktes des Redens beschrieben wird. Sprachtalent, im Sinne von Sinn für Analogie und Differenz, ist essentiell.
Welche Herausforderungen ergeben sich bei Schleiermachers Übersetzungsmethoden?
Die Arbeit beleuchtet das Spannungsfeld zwischen der originalgetreuen Wiedergabe und der adäquaten Verständlichkeit für die Zielgruppe. Es werden die spezifischen hermeneutischen Probleme im Übersetzungsprozess untersucht, wie die Herausforderungen der Interpretation und die Schwierigkeiten, die sich aus unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Kontexten ergeben.
Wie geht Schleiermacher mit den Herausforderungen der Übersetzung um?
Die Arbeit analysiert, wie Schleiermachers Übersetzungsansätze von seinem hermeneutischen Hintergrund geprägt sind und inwiefern sie diesem gerecht werden. Sie untersucht im Detail, wie Schleiermacher die Herausforderungen, die sich aus den unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Kontexten ergeben, in seiner Praxis angegangen ist.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit in der Zusammenfassung der Kapitel aufgeführt und müsste aus dem vollständigen Text entnommen werden.)
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
(Eine Liste mit Schlüsselbegriffen fehlt in der gegebenen Vorschau. Diese müssten aus dem vollständigen Text entnommen werden.)
- Arbeit zitieren
- Anne Haupt (Autor:in), 2022, Friedrich D. E. Schleiermachers Hermeneutik und seine Übersetzungsmethoden, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1239700