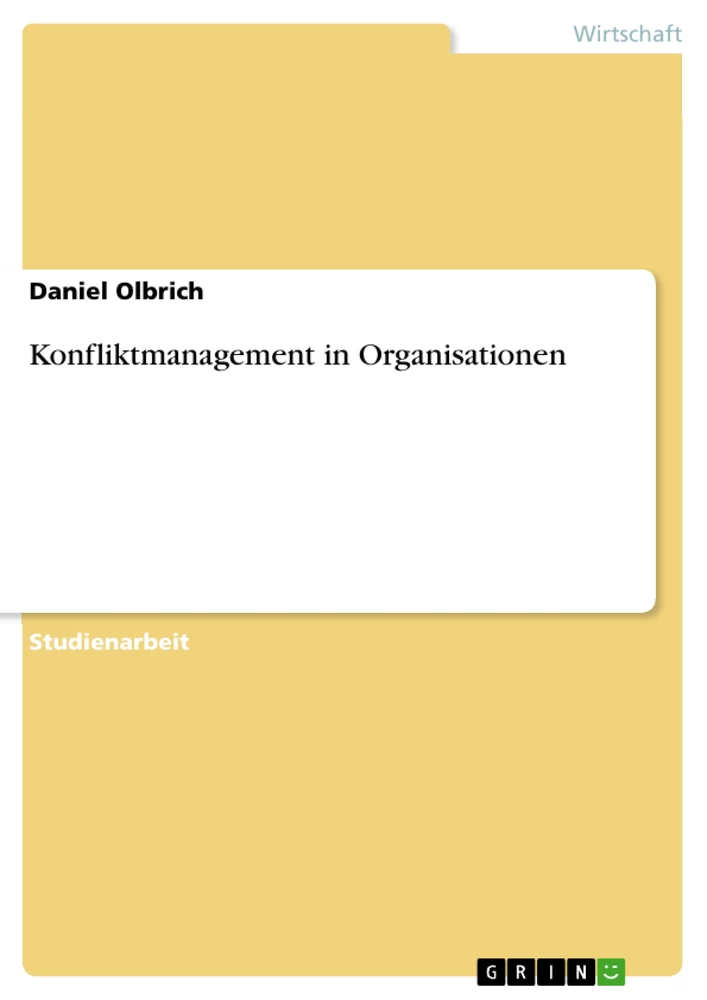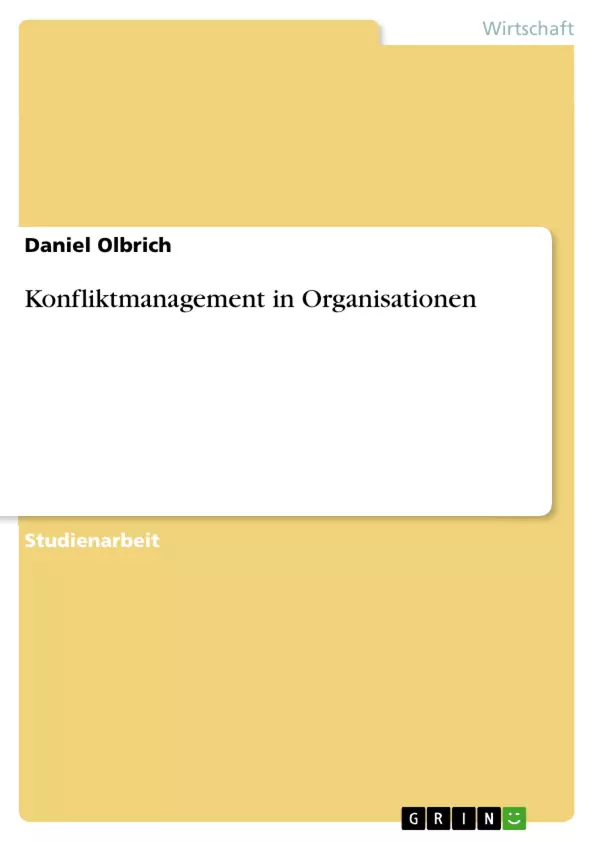Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf Konflikten und Konfliktmanagement in Organisationen. Was zunächst leise und unauffällig erscheint, kann auf lange Sicht große Auswirkungen haben. Dies gilt besonders, wenn es sich um Konflikte handelt. Durch geeignete Methoden lassen sich die Auswirkungen kontrollieren und beeinflussen. Eine Methode ist das Konfliktmanagement, das Gegenstand dieser Arbeit ist. Dabei ist es wesentlich zu klären, was Konflikte sind, wie sie unterschieden werden und wo die Ursachen liegen. Darüber hinaus soll analysiert werden, welche Dynamiken bei der Eskalation von Konflikten eine Rolle spielen und welche Taktiken die Beteiligten anwenden, um sie zu beeinflussen. Außerdem sollen Strategien zur Konfliktbewältigung identifiziert werden, die zur Lösung beitragen. Überall, wo Menschen zusammenarbeiten, wird es früher oder später zu Konflikten kommen. Im operativen Geschäft von Organisationen ist die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Personen und Abteilungen ein zentrales Merkmal.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Konflikt
- Unterscheidungsmöglichkeiten von Konflikten
- Streitgegenstand
- Erscheinungsform
- Konfliktparteien
- Interpersonale Konflikte
- Gruppenkonflikte
- Organisationale Konflikte
- Ursachen für Konflikte
- Zieldivergenzen
- Persönlichkeitsmerkmale
- Kommunikationsdefizite
- Sachzwänge
- Organisation, Systeme und Strukturen
- Stile der Konfliktbewältigung
- Integrieren
- Entgegenkommen
- Dominieren
- Vermeiden
- Kompromissbereitschaft
- Konfliktdynamik
- Konfliktmodell nach Pondy
- Latenter Konflikt
- Wahrgenommener Konflikt
- Erlebter Konflikt
- Manifester Konflikt
- Konfliktnachwirkungen
- Konfliktmodell nach Glasl
- Win-Win-Ebene
- Win-Lose-Ebene
- Lose-Lose-Ebene
- Auswirkungen von Konflikten
- Interventionsstrategien
- Moderator
- Prozessbegleiter
- System-therapeutisch orientierte Prozessbegleitung
- Vermittlung/Mediation
- Schiedsverfahren
- Strategie des Machteingriffes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Belegarbeit befasst sich mit dem Thema Konfliktmanagement in Organisationen. Sie analysiert verschiedene Facetten des Konflikts, von seiner Definition über Ursachen und Dynamik bis hin zu Strategien der Konfliktbewältigung. Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis für den Umgang mit Konflikten in der Praxis zu entwickeln.
- Definition und Einordnung des Begriffs „Konflikt“
- Unterscheidungsmöglichkeiten von Konflikten nach Streitgegenstand, Erscheinungsform und Konfliktparteien
- Ursachenanalyse von Konflikten in Organisationen
- Eskalationsdynamik von Konflikten und verschiedene Konfliktmodelle
- Strategien der Konfliktbewältigung und Interventionsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Konfliktmanagement ein und unterstreicht die Bedeutung des Themas für die Zusammenarbeit in Organisationen. Kapitel 2 befasst sich mit der Definition des Begriffs „Konflikt“ und erläutert verschiedene Ansätze aus der Literatur. Kapitel 3 analysiert die Unterscheidungsmöglichkeiten von Konflikten nach Streitgegenstand, Erscheinungsform und Konfliktparteien. Kapitel 4 untersucht verschiedene Ursachen für Konflikte in Organisationen, darunter Zieldivergenzen, Persönlichkeitsmerkmale, Kommunikationsdefizite, Sachzwänge und organisationale Strukturen. Kapitel 5 präsentiert verschiedene Stile der Konfliktbewältigung, darunter Integrieren, Entgegenkommen, Dominieren, Vermeiden und Kompromissbereitschaft. Kapitel 6 beleuchtet die Eskalationsdynamik von Konflikten und stellt verschiedene Konfliktmodelle vor, darunter das Konfliktmodell nach Pondy und das Konfliktmodell nach Glasl.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Themenbereich Konfliktmanagement und beleuchtet zentrale Aspekte wie Konfliktdefinition, Konflikttypen, Ursachenanalyse, Konfliktdynamik, Konfliktmodelle und Interventionsstrategien. Wichtige Themenfelder sind unter anderem interpersonale und organisationale Konflikte, Zieldivergenzen, Kommunikationsdefizite, Eskalation, Mediation und Schiedsverfahren.
- Quote paper
- Daniel Olbrich (Author), 2022, Konfliktmanagement in Organisationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1239490