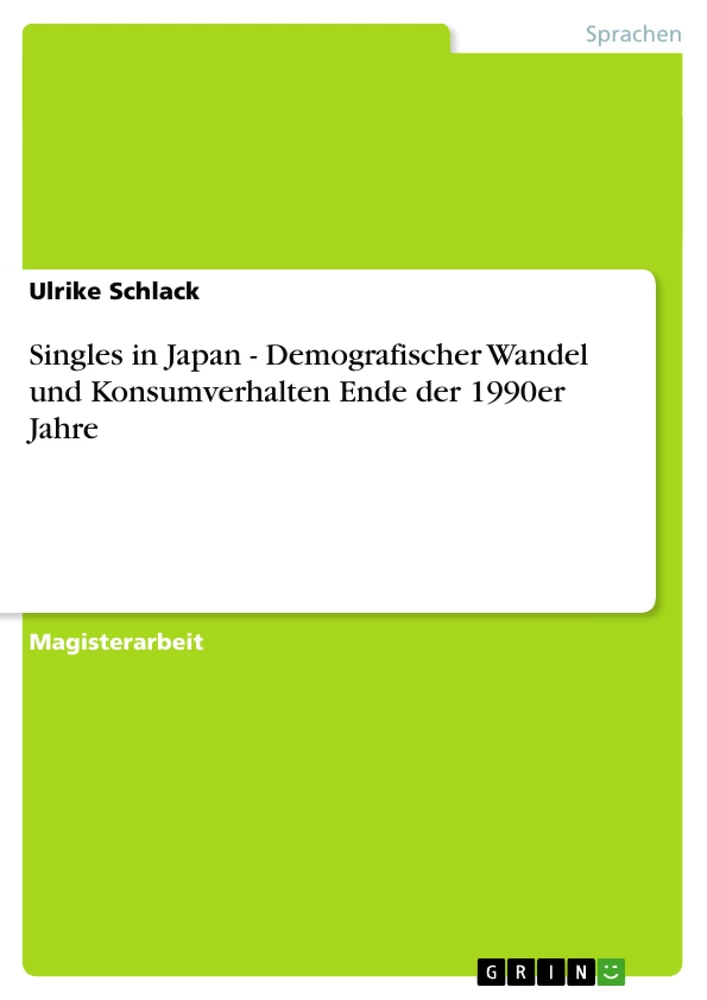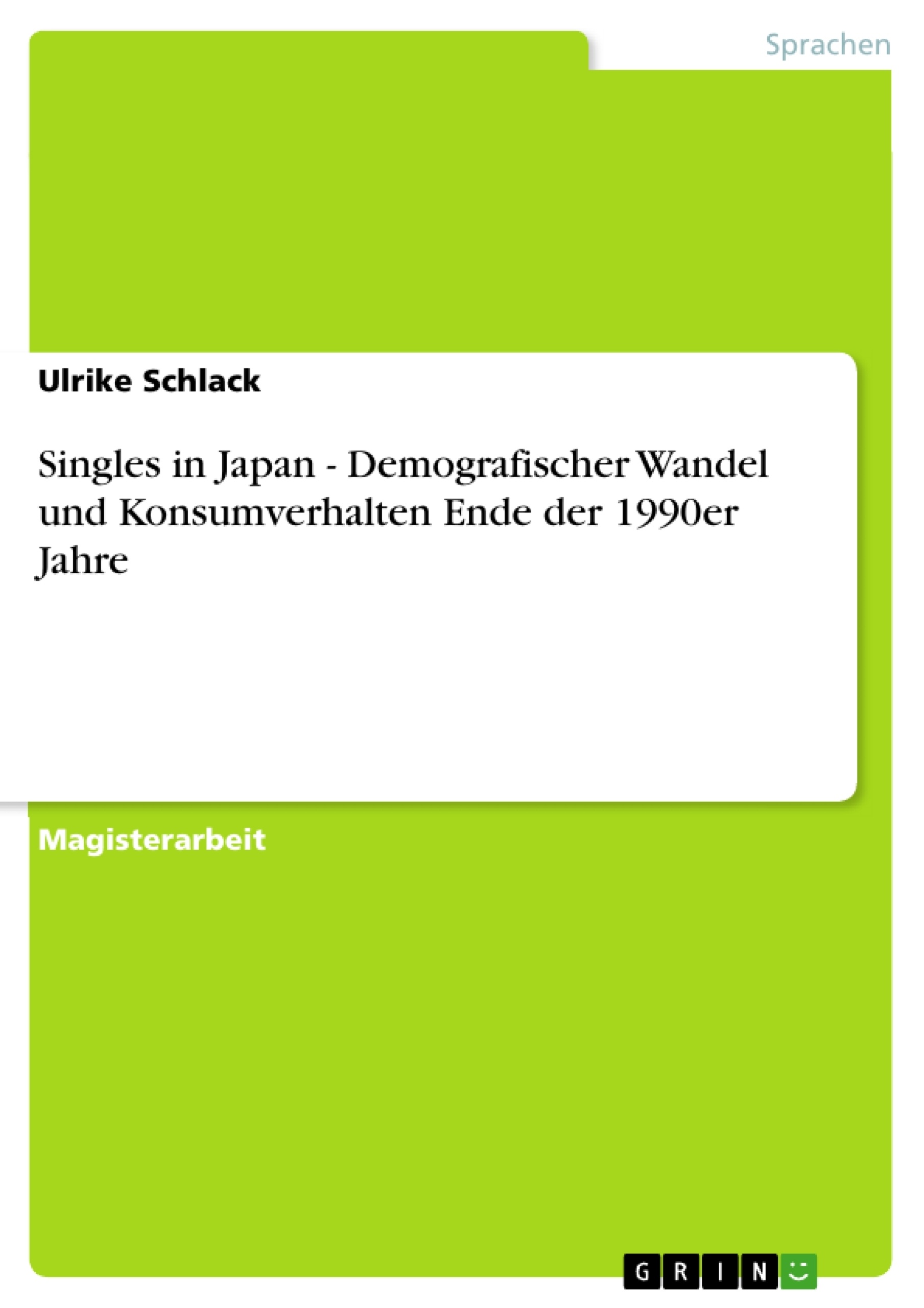„Ich hab schon alles, ich will noch mehr, alles hält ewig, jetzt muß was Neues her. Ich könnt im Angebot ersaufen, mich um Sonderposten raufen, hab diverse Kredite laufen [...] ich kauf’ mir was, kaufen macht soviel Spaß, ich könnte ständig kaufen gehen, kaufen ist wunder-schön.“ Diese Zeilen aus einem Song von dem deutschen Popsänger Herbert Grönemeyer aus dem Jahr 1982 könnten auch auf die sogenannten Parasiten-Singles in Japan passen, die in den letzten Jahren durch ihre hedonistische Lebensweise auf sich aufmerksam gemacht haben und noch immer für ausreichend Gesprächsstoff sorgen.
„Auch mit über dreißig Jahren wohnen sie noch zu Hause bei den Eltern, machen in ihrer Freizeit Auslandsreisen, auf denen sie teure Markenartikel kaufen und führen alles in allem ein gemütliches Leben - dies sind die unbekümmerten und unverheirateten jungen Männer und Frauen Japans - die Parasiten-Singles.“ So beschreibt sie Yamada Masahiro in seinem Buch „Das Zeitalter der Parasiten-Singles“ (Parasaito shinguru no jidai). Yamada, Professor der Soziologie an der Universität für Kunst und Wissenschaft in Tôkyô spezialisierte sich auf dem Gebiet der Eltern-Kind-Beziehung sowie ehelichen Beziehungen zwischen Mann und Frau, wozu er verschiedene Veröffentlichungen wie „Das Risiko namens Familie“ (Kazoku to iu risuku) oder „Die Restrukturierung der Familie“ (Kazoku no resutorakuchâringu) heraus-gegeben hat. In dem erstgenannten Buch „Das Zeitalter der Parasiten-Singles“ versucht er, dem zur Zeit nicht mehr nur japanspezifischen Phänomen auf den Grund zu gehen. Da die „Parasiten-Singles“ aus Bequemlichkeit länger unverheiratet bleiben, macht sie der Soziologe für die sinkende Geburtenrate verantwortlich. Laut Yamada sind es grundsätzlich die jungen Menschen Japans, die unter dem Dach der Eltern und auf Kosten der Eltern leben und dies in vollen Zügen genießen, er verurteilt sie wegen ihres hedonistischen Lebensstils und warnt auch vor Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft, bezeichnet sie als das Symbol der Sackgasse, in der sich Japan gegenwärtig befindet.
Die mit einer stark pejorativen Konnotation behafteten Bezeichnung „Parasiten-Singles“ gab mir den Anstoß, dieses Phänomen näher zu untersuchen. Hauptanliegen dieser Arbeit soll es sein, Yamadas These einer gründlichen Prüfung zu unterziehen und eine differenzierende sowie sachlichere Darlegung zu liefern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Empirische Befunde
- Tendenzen in der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur in Japan
- Bevölkerungsverteilung nach Altersgruppen und durchschnittliche Lebenserwartung
- Geburten- und Sterbeziffern, Eheschließungen und Ehescheidungen
- Haushaltsgröße
- Analysen und Fazit
- Entwicklung des Single-Daseins in Japan
- Vorbetrachtung
- ,,Parasiten-Singles" in Japan
- Charakteristische Paras I
- Charakteristische(?) Paras II
- Non-paras - die Gegenspieler
- Exkurs: Konsumtheorie – ein Definitionsversuch
- Der wirtschaftliche Kontext
- Der sozialwissenschaftliche Kontext
- Konsum in Japan
- Konsum Ausdruck des Lebensstils der Singles in Japan
- Vorbetrachtung
- Lebensstil in Japan
- Freizeit als gegenwärtiges Phänomen
- Shopping als neue Freizeitbeschäftigung
- Käuferverhalten und Präferenzbildung
- Kaufentscheidungsprozesse
- Konsumverhalten paras vs. non-paras
- Die Äußerlichkeiten der paras und non-paras
- Der Konsum der paras
- Das non-bura-Konzept
- Die Brillanz der non-paras
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht das Phänomen der „Parasiten-Singles“ in Japan Ende der 1990er Jahre. Ziel ist es, den Lebensstil dieser unverheirateten jungen Erwachsenen im Kontext des demografischen Wandels und des Konsumverhaltens zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet sowohl die soziologischen als auch die ökonomischen Aspekte dieses gesellschaftlichen Trends.
- Demografischer Wandel in Japan und dessen Einfluss auf das Single-Dasein
- Der Lebensstil und das Konsumverhalten von „Parasiten-Singles“
- Vergleich zwischen „Parasiten-Singles“ und „Non-Parasiten-Singles“
- Der Einfluss des Konsums auf die Identität und den Selbstwert der Singles
- Die sozioökonomischen Implikationen des steigenden Anteils an Singles in Japan
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der „Parasiten-Singles“ in Japan ein und benennt den Forschungsgegenstand. Sie stellt den Begriff kritisch dar und verweist auf die kontroverse Diskussion um diesen Lebensstil und dessen gesellschaftliche Folgen. Der Fokus der Arbeit auf die Analyse des Konsumverhaltens im Kontext des demografischen Wandels wird klar formuliert.
Empirische Befunde: Dieses Kapitel präsentiert empirische Daten zur demografischen Entwicklung Japans, darunter Bevölkerungsverteilung, Geburten- und Sterberaten, Eheschließungen und -scheidungen sowie Haushaltsgrößen. Es analysiert die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur und deren Relevanz für das Single-Dasein. Die statistischen Daten bilden die Grundlage für die weitere Analyse des Phänomens „Parasiten-Singles“.
Entwicklung des Single-Daseins in Japan: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Single-Daseins in Japan. Es differenziert zwischen den „Parasiten-Singles“, die bei ihren Eltern leben und einen hedonistischen Lebensstil pflegen, und den „Non-Parasiten-Singles“, die unabhängig leben. Die Charakteristika beider Gruppen werden kontrastiert und in den gesellschaftlichen Kontext eingeordnet.
Exkurs: Konsumtheorie – ein Definitionsversuch: Dieser Exkurs beleuchtet relevante Konsumtheorien, sowohl aus wirtschaftlicher als auch sozialwissenschaftlicher Perspektive. Er liefert das theoretische Rüstzeug für die anschließende Analyse des Konsumverhaltens der „Parasiten-Singles“. Der Abschnitt verbindet theoretische Konzepte mit der empirischen Realität Japans.
Konsum Ausdruck des Lebensstils der Singles in Japan: Dieses Kapitel analysiert den Konsum als Ausdruck des Lebensstils der Singles in Japan. Es untersucht Freizeitaktivitäten, Shoppingverhalten, Kaufentscheidungsprozesse und Präferenzbildung. Der Zusammenhang zwischen Konsum und der Konstruktion von Identität und sozialem Status wird erörtert.
Konsumverhalten paras vs. non-paras: Das Kapitel vergleicht das Konsumverhalten von „Parasiten-Singles“ und „Non-Parasiten-Singles“. Es analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Konsumverhalten beider Gruppen und deutet deren Bedeutung für die gesellschaftliche Wahrnehmung und Bewertung der verschiedenen Lebensstile.
Schlüsselwörter
Parasiten-Singles, Demografischer Wandel, Konsumverhalten, Japan, Lebensstil, Non-Parasiten-Singles, Hedonismus, Sozioökonomie, Haushaltsstruktur, Bevölkerungsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: "Parasiten-Singles" in Japan
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht das Phänomen der „Parasiten-Singles“ in Japan Ende der 1990er Jahre. Im Fokus steht die Analyse ihres Lebensstils im Kontext des demografischen Wandels und des Konsumverhaltens, wobei sowohl soziologische als auch ökonomische Aspekte beleuchtet werden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den demografischen Wandel in Japan und dessen Einfluss auf das Single-Dasein, den Lebensstil und das Konsumverhalten von „Parasiten-Singles“, einen Vergleich zwischen „Parasiten-Singles“ und „Non-Parasiten-Singles“, den Einfluss des Konsums auf Identität und Selbstwert der Singles sowie die sozioökonomischen Implikationen des steigenden Anteils an Singles in Japan.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit empirischen Befunden zur demografischen Entwicklung Japans, ein Kapitel zur Entwicklung des Single-Daseins in Japan mit Unterscheidung zwischen „Parasiten-Singles“ und „Non-Parasiten-Singles“, einen Exkurs zu relevanten Konsumtheorien, ein Kapitel zum Konsum als Ausdruck des Lebensstils japanischer Singles, ein Kapitel zum Vergleich des Konsumverhaltens beider Gruppen und eine Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Was sind „Parasiten-Singles“?
„Parasiten-Singles“ ist ein in der Arbeit diskutierter Begriff für unverheiratete junge Erwachsene in Japan, die bei ihren Eltern leben und einen oft als hedonistisch beschriebenen Lebensstil pflegen. Die Arbeit beleuchtet den Begriff kritisch und verweist auf die kontroverse Diskussion um diesen Lebensstil und seine gesellschaftlichen Folgen.
Wie unterscheidet sich die Arbeit zwischen „Parasiten-Singles“ und „Non-Parasiten-Singles“?
Die Arbeit differenziert zwischen „Parasiten-Singles“, die bei ihren Eltern leben und einen hedonistischen Lebensstil pflegen, und „Non-Parasiten-Singles“, die unabhängig leben. Die Charakteristika beider Gruppen werden kontrastiert und in den gesellschaftlichen Kontext eingeordnet, insbesondere im Hinblick auf ihr Konsumverhalten.
Welche Rolle spielt der Konsum in der Arbeit?
Der Konsum spielt eine zentrale Rolle, da er als Ausdruck des Lebensstils der Singles analysiert wird. Die Arbeit untersucht Freizeitaktivitäten, Shoppingverhalten, Kaufentscheidungsprozesse und Präferenzbildung beider Gruppen und erörtert den Zusammenhang zwischen Konsum und der Konstruktion von Identität und sozialem Status.
Welche empirischen Daten werden verwendet?
Die Arbeit präsentiert empirische Daten zur demografischen Entwicklung Japans, darunter Bevölkerungsverteilung, Geburten- und Sterberaten, Eheschließungen und -scheidungen sowie Haushaltsgrößen. Diese Daten bilden die Grundlage für die Analyse des Phänomens „Parasiten-Singles“.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind nicht im bereitgestellten Text der HTML-Struktur enthalten, da diese im Kapitel "Zusammenfassung" zu finden sind.) Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse der Analyse des Lebensstils und des Konsumverhaltens von "Parasiten-Singles" im Kontext des demografischen Wandels zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Parasiten-Singles, Demografischer Wandel, Konsumverhalten, Japan, Lebensstil, Non-Parasiten-Singles, Hedonismus, Sozioökonomie, Haushaltsstruktur, Bevölkerungsentwicklung.
- Quote paper
- Ulrike Schlack (Author), 2003, Singles in Japan - Demografischer Wandel und Konsumverhalten Ende der 1990er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/123917