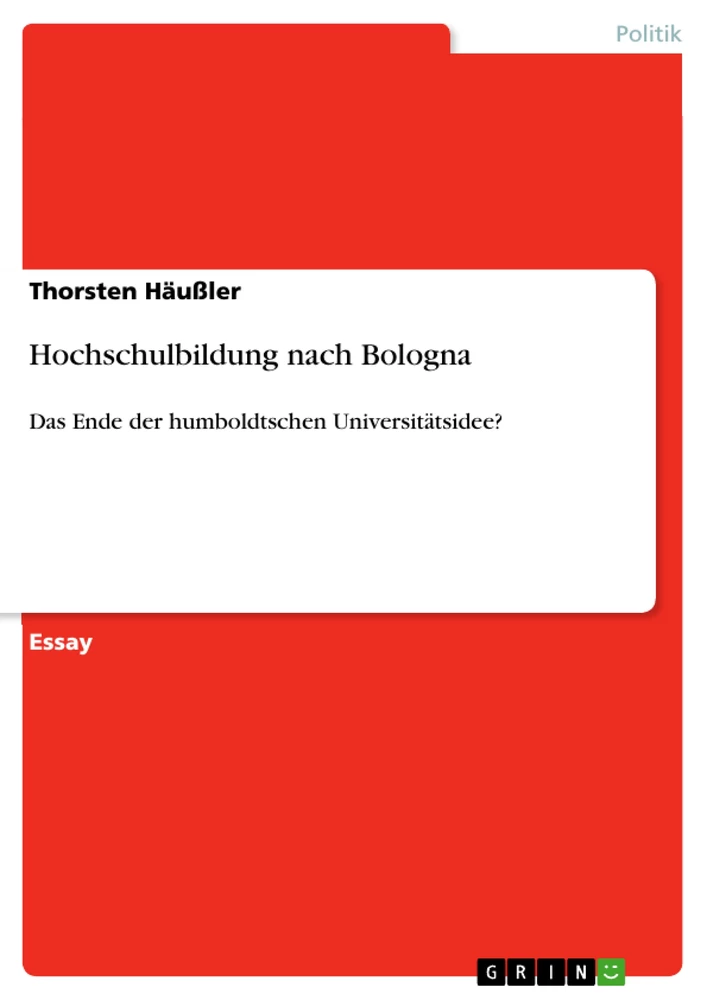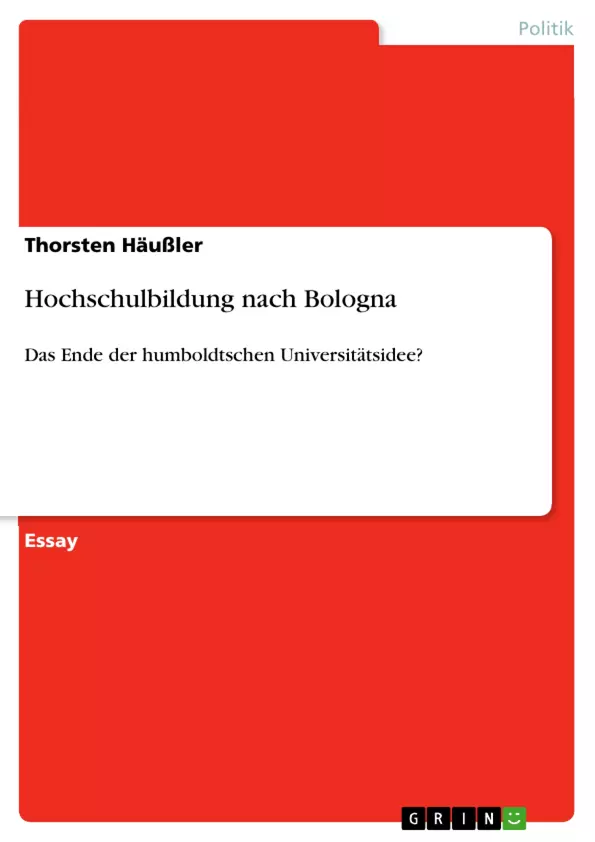„Die Bildung wird täglich geringer, weil die Hast größer wird.“ Angesichts der Reformwut der vergangenen Jahre im Bildungssektor scheint dieser Ausspruch von Friedrich Nietzsche eine bisher unerreichte Brisanz für den europäischen Hochschulraum zu bekommen. Die Reformbemühungen, welche ihren vorläufigen Gipfel im Bolognaprozess fanden, bedeuten für viele Verantwortungsträger an den Universitäten eine immer weiter voranschreitende Aufgabe des Bildungsideals, welches Wilhelm von Humboldt bereits im frühen 19. Jahrhundert für die deutsche Bildungslandschaft formuliert hatte und welches seitdem weltweit als angesehenes Modell von diversen Bildungsträgern adaptiert wurde. Es gilt also zu prüfen, ob dieser Prozess zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes tatsächlich das Ende der klassischen Universität in Europa bedeutet.
Inhaltsverzeichnis
- Humboldts Universitätsidee
- Der Bachelor als Abschied vom Bildungsideal
- Akademische Unfreiheit
- Aufbruch der Einheit von Forschung und Lehre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf die klassische Universitätsidee nach Wilhelm von Humboldt. Es wird analysiert, inwieweit die Reformbemühungen zu einer Abkehr von Humboldts Bildungsideal geführt haben.
- Humboldts Konzept der Allgemeinbildung und die Einheit von Forschung und Lehre
- Der Einfluss des Bologna-Prozesses auf die universitäre Lehre und die akademische Freiheit
- Die zunehmende Ökonomisierung der Wissenschaft und ihre Auswirkungen auf die Forschung
- Die Entwicklung der universitären Karriere und die Abwertung der Lehre
- Die Frage nach dem Fortbestand der Humboldt'schen Universität im europäischen Hochschulraum
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschreibt Humboldts Universitätsideal, charakterisiert durch Allgemeinbildung, die Einheit von Forschung und Lehre, und akademische Freiheit. Das zweite Kapitel analysiert den Bachelor-Abschluss im Kontext des Bologna-Prozesses und argumentiert, dass er eine Abkehr von Humboldts Bildungsideal darstellt. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Thema der akademischen Unfreiheit, hervorgerufen durch die zunehmende Ökonomisierung der Wissenschaft und die Modularisierung der Studienstrukturen. Das vierte Kapitel untersucht den Zerfall der Einheit von Forschung und Lehre, der durch die Priorisierung der Forschung und die Abwertung der Lehre entsteht.
Schlüsselwörter
Bologna-Prozess, Humboldt'sche Universitätsidee, Allgemeinbildung, Einheit von Forschung und Lehre, Akademische Freiheit, Ökonomisierung der Wissenschaft, Bachelor-Abschluss, Drittmittelforschung.
- Quote paper
- Thorsten Häußler (Author), 2009, Hochschulbildung nach Bologna, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/123700