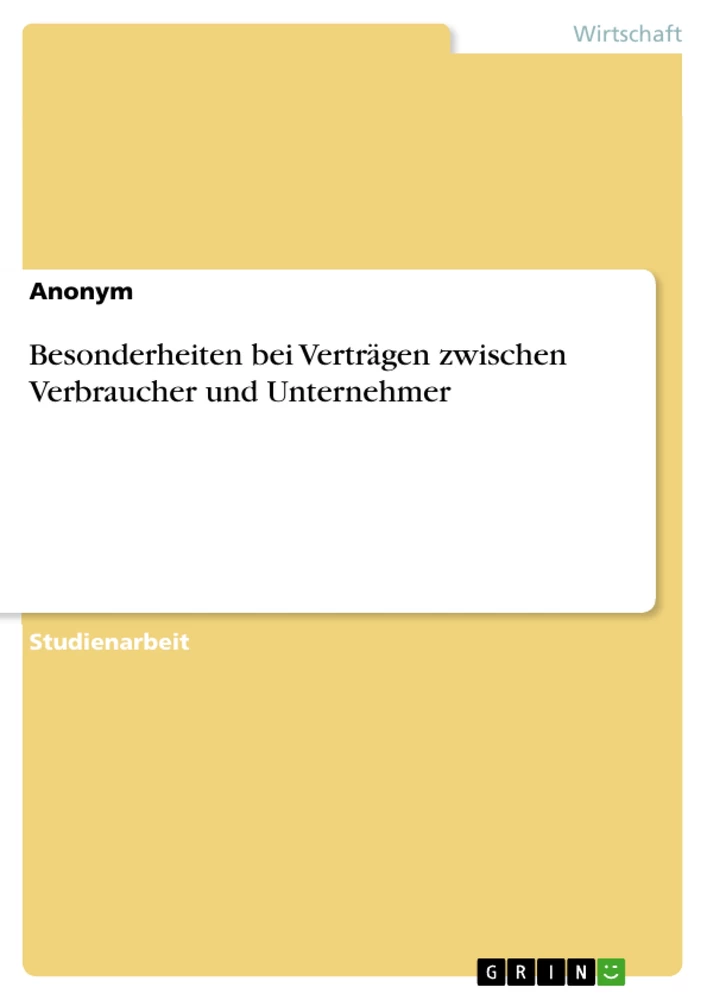Sollte sich die Politik mehr mit verbraucherschutzrechtlichen Themen befassen? Laut einer Umfrage der Forsa im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes nehmen Deutsche an, dass die Unternehmerinteressen und Interessen für den Umweltschutz vor die Interessen der Verbraucher gestellt werden. Nur 39% der Befragten denken, dass Verbraucherschutz stark von der Politik berücksichtigt wird.
Regelmäßig kommen Verbraucher in Kontakt mit Bestellungen und somit mit Kaufverträgen. Bei Kaufverträgen, die mit Unternehmern abgeschlossen wurden, herrscht ein Ungleichgewicht bezüglich des Wissens, der Fachkenntnis und der Informationen. Die Verbraucher haben durch ihre Unerfahrenheit einen Nachteil gegenüber den Unternehmern und können somit leicht übervorteilt werden. Durch Unwissenheit werden Verbraucher Opfer von Kostenfallen, unerwarteten Abonnement-Abschlüssen und Betrug. Der Verbraucherschutz soll dieses Ungleichgewicht ausbalancieren und soll den Verbraucher in seiner Position stärken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Verbrauchervertrag
- Verbraucher
- Unternehmer
- Definition Verbrauchervertrag
- Verbrauchsgüterkauf
- Verbraucherschutz
- Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag
- Definition
- Beispiele
- Fernabsatzverträge
- Definition
- Beispiele
- Informationspflicht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen
- Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen
- Besondere Schutzvorschriften
- Kauf im Online Shop
- Download und Streaming
- Schlussbetrachtung
- Zusammenfassung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit den Grundlagen der Verbraucherrechte und des Verbrauchsgüterkaufs. Sie erläutert Besonderheiten beim Verbrauchsgüterkauf zum Schutz des Verbrauchers und verdeutlicht die Schutzbedürftigkeit der Verbraucher anhand von Definitionen und Beispielen.
- Grundlagen des Verbrauchervertrags und der Begriffe Unternehmer und Verbraucher
- Besondere Vorschriften im Verbrauchsgüterkauf
- Verbraucherschutz und seine Notwendigkeit
- Besonderheiten bei Verbraucherverträgen bei außerhalb von geschlossenen Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen
- Informations- und Widerrufspflichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit. Kapitel 2 definiert die Begriffe Verbraucher und Unternehmer und erläutert die Grundlagen des Verbrauchervertrags sowie die Rechte beim Verbrauchsgüterkauf anhand des Bürgerlichen Gesetzbuches. Kapitel 3 widmet sich dem Thema Verbraucherschutz und behandelt die Besonderheiten bei Verbraucherverträgen, insbesondere bei außerhalb von geschlossenen Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen. Darüber hinaus werden die Informations- und Widerrufspflichten beschrieben.
Schlüsselwörter
Verbraucherrecht, Verbraucherschutz, Verbrauchervertrag, Unternehmer, Verbrauchsgüterkauf, außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, Fernabsatzverträge, Informationspflicht, Widerrufsrecht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Besonderheiten bei Verträgen zwischen Verbraucher und Unternehmer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1235008