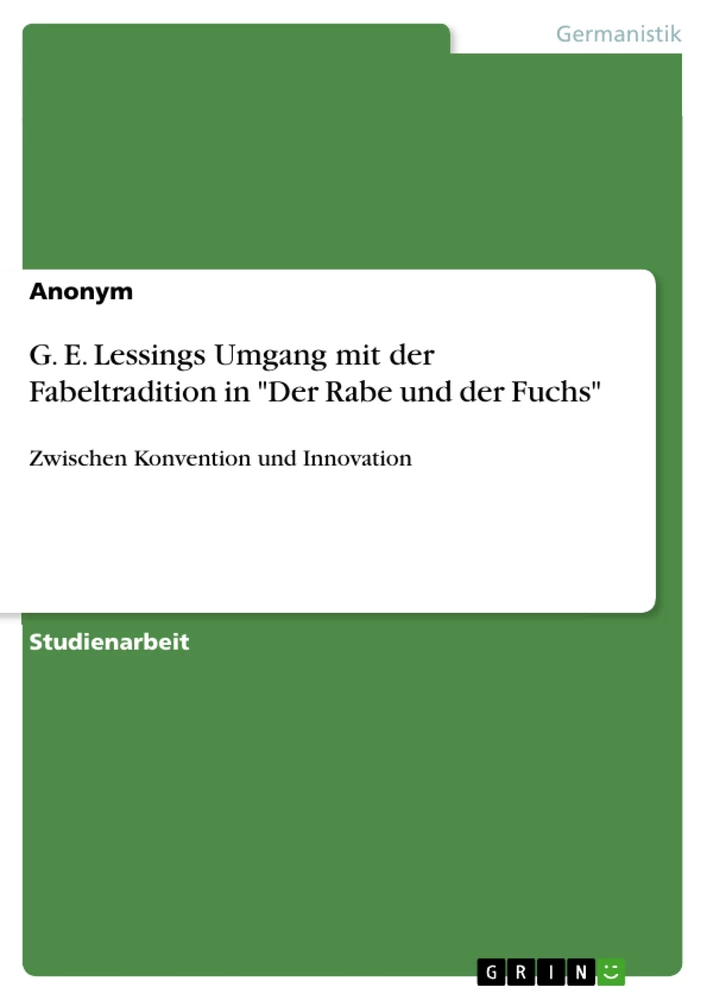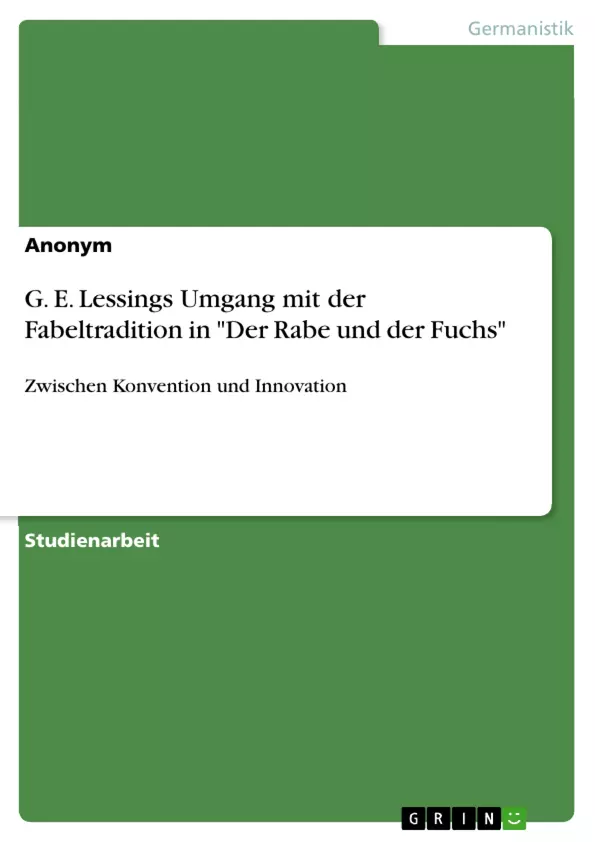Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage nach dem Verhältnis von Tradition und Innovation in der Fabel „Der Rabe und der Fuchs“ Lessings. Obwohl innerhalb der Fabeltradition auch vollkommen neue Geschichten erfunden werden, bestehen die meisten Fabeln aus der Modifikation und Neubearbeitung überlieferter Stoffe, die im uns dokumentierten ältesten Fall aus der griechischen Antike stammen. Fuchs und Rabe kämpfen ebenfalls bereits seit der Antike um ihre Beute und zählen zu den bekanntesten Kontrahenten innerhalb der Fabeltradition.
Die Einzelanalysen der Fabeln Aesops, Phaedrus', La Fontaines und Lessings werden in dieser Arbeit aufbauend vergleichend betrachtet. Zudem wird von Beginn an Lessings Verhältnis zu den einzelnen Fabeldichtern erörtert, welches aus Lessings Abhandlungen über die Fabel hervorgeht. Dementsprechend beginnt die Arbeit mit einer Darstellung der Rahmeninformationen zu Aesop und einer Analyse von dessen Fabelversion, der in diesem Fall Ältesten uns überlieferten. Darauf folgt die Betrachtung der Bearbeitung des Fabeldichters Phaedrus. Nach den beiden antiken Fabeldichtern reiht im dritten Kapitel dieser Arbeit der Einfluss der französischen Fabeldichtung mit La Fontaine an. Auch hier wird zunächst die Kritik Lessings an La Fontaine aufgeführt, worauf die eigentliche Analyse der Fabelversion folgt. Die drei Autoren wurden für diese Arbeit ausgewählt, da sie zum einen den größten Einfluss auf die Bearbeitung Lessings haben und zum anderen, weil Lessing sich explizit auf Aesop und Phaedrus bezieht. Im vierten Kapitel folgt dann die abschließende Analyse der Version Lessings, in der ein besonderes Augenmerk auf die in dieser Fabel untersuchten traditionellen und innovativen Elemente gelegt wird. Schließlich folgt ein kurzer abschließender Vergleich der Fabelbearbeitungen, in dem die Ergebnisse der Arbeit noch einmal zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lessings Quellen: Die antike Fabel bei Aesop und Phaedrus
- Der Rückgriff auf die aesopische Fabeltradition
- Die Fabel „Der Fuchs und der Rabe“ Aesops
- Lessings kontroverses Verhältnis zu Phaedrus
- Die Fabel „Der Fuchs und der Rabe“ bei Phaedrus
- Einfluss französischer Fabeldichtung: Jean de La Fontaine
- Lessings Kritik an der „lustigen Schwatzhaftigkeit“ La Fontaines
- La Fontaines Fabelbearbeitung von „Der Fuchs und der Rabe“
- Analyse der Fabelversion „Der Rabe und der Fuchs“ Lessings
- Abschließender Vergleich der Fabelversionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Tradition und Innovation in Gotthold Ephraim Lessings Fabel „Der Rabe und der Fuchs“. Der Fokus liegt auf der Analyse der Fabel im Kontext der antiken Fabeltradition, insbesondere in Bezug auf die Werke von Aesop und Phaedrus, sowie der französischen Fabeldichtung Jean de La Fontaines.
- Die Entwicklung der Fabel „Der Fuchs und der Rabe“ von der Antike bis zur Bearbeitung durch Lessing
- Lessings Verhältnis zu den antiken Fabeldichtern und La Fontaine
- Die traditionelle und innovative Aspekte in Lessings Version der Fabel
- Ein vergleichender Blick auf die verschiedenen Fabelversionen von Aesop, Phaedrus, La Fontaine und Lessing
- Der Stellenwert von „Der Rabe und der Fuchs“ im Werk Lessings und in der Fabeltradition insgesamt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Fabel „Der Rabe und der Fuchs“ Lessings und stellt die Relevanz dieser Fabel für die Fabelgattung insgesamt dar. Im zweiten Kapitel werden Lessings Quellen in der antiken Fabeltradition beleuchtet, wobei der Fokus auf die Werke von Aesop und Phaedrus liegt. Dabei wird Lessings Kritik an der „lustigen Schwatzhaftigkeit“ La Fontaines erläutert und dessen Fabelversion von „Der Fuchs und der Rabe“ analysiert. Das vierte Kapitel befasst sich schließlich mit der Analyse der Fabelversion Lessings und der traditionellen sowie innovativen Elemente, die darin zum Ausdruck kommen.
Schlüsselwörter
Fabel, Tradition, Innovation, Aesop, Phaedrus, La Fontaine, Lessing, „Der Rabe und der Fuchs“, Fabeltradition, Literaturwissenschaft, Gattungsgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, G. E. Lessings Umgang mit der Fabeltradition in "Der Rabe und der Fuchs", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1234628