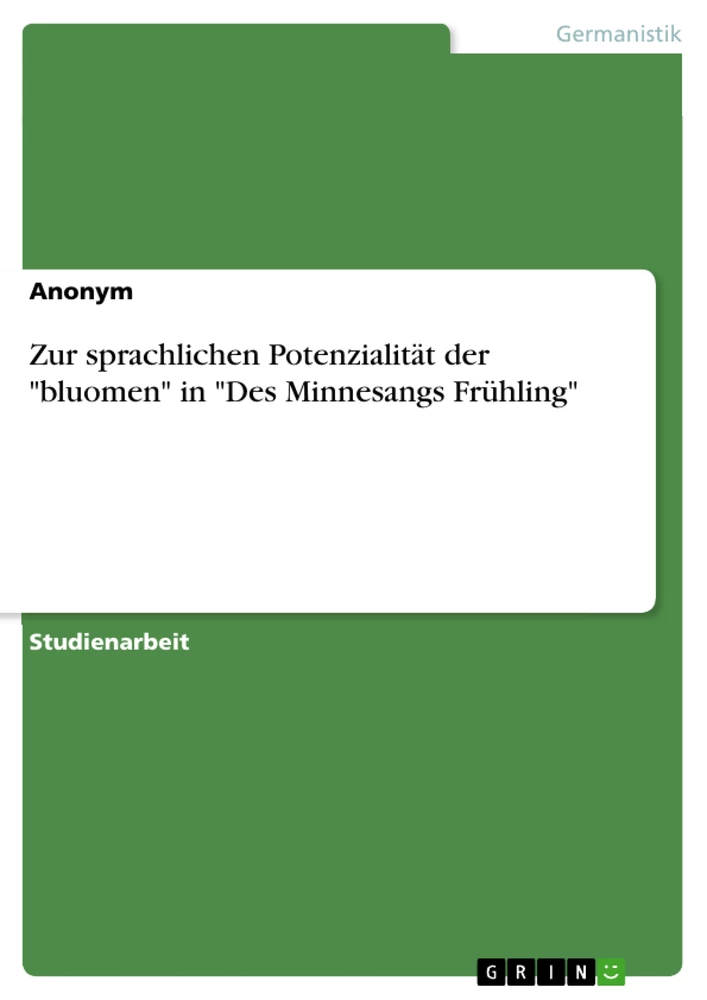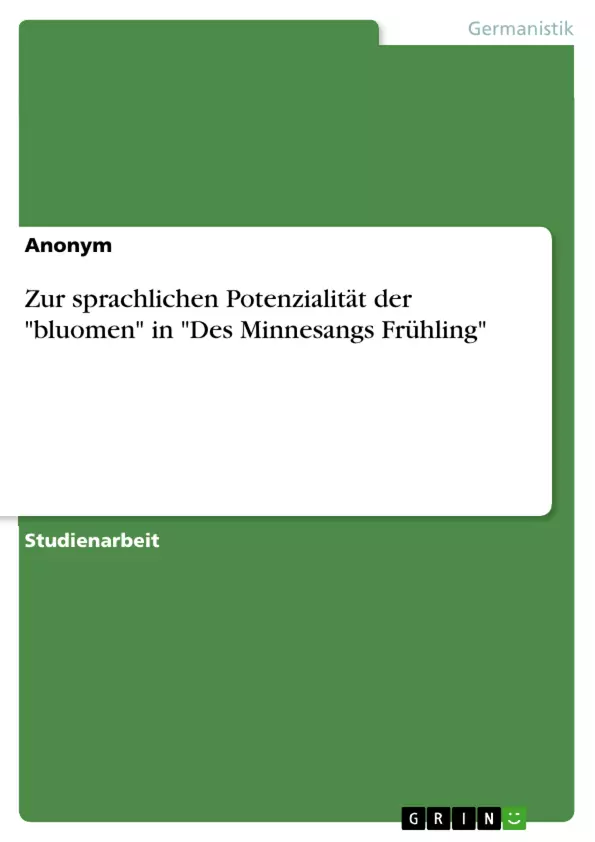Blumen gelten unter anderem als Symbole der Dichtung und der Liebe. Es liegt also durchaus nahe, ihre symbolische Potenzialität in der mittelhochdeutschen Liebes-Dichtung zu untersuchen. Das Referenzspektrum ihrer Symbolik reicht darüber hinaus, ausgehend von ihrer Schönheit und Farbe und auch ihrer Zartheit und relativer Seltenheit, vom Symbol für die Geliebte oder den Geliebten über die Dichtung bis hin zur Symbolik für Unsterblichkeit und auch Vergänglichkeit.
Sie begegnen uns in der mittelhochdeutschen Minnelyrik neben anderen Elementen der Natur, wie zum Beispiel Vögeln oder auch anderen Pflanzen wie der linde, der heide oder dem klê, relativ häufig, da es sich um einen Bestandteil eines gesellschaftlich bedeutsamen Themas, der Jahreszeiten, handelt. Damit sind sie Teil einer Naturdarstellung, welche die Minnelieder oftmals einleitet (Natureingang) oder in Zusammenhang mit der sogenannten Jahreszeitentopik gebraucht wird.
Doch welche konkrete Symbolik oder Metaphorik entfalten sie im Minnesang? Wie weit öffnet sich ihr sprachliches Spektrum in den uns überlieferten Minneliedern? Welche Funktionen übernehmen sie innerhalb der Jahreszeitentopik und wie werden sie zur Minnethematik in Beziehung gesetzt?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Leitfragen, Methodik und Aufbau der Arbeit
- 1.2 Zum Stand der Forschung
- 2 bluomen als Boten des sumers
- 2.1 Mittelalterliches, gesellschaftliches Leben im jahreszeitlichen Wechsel
- 2.2 Die Jahreszeitentopik
- 3 Exemplarisch: Zur Funktion der bluomen in Dietmars von Eist Ahî, nu kumt uns diu zît (MF 33, 15)
- 3.1 Kurzer überlieferungsgeschichtlicher Überblick
- 3.2 Formale und inhaltliche Analyse des Liedes mit Blick auf die Funktion der bluomen in der Jahreszeitentopik
- 3.3 Handelt es sich um eine liedhafte komponierte Einheit der Strophen?
- 4 bluomen – mehr als nur boten des sumers
- 4.1 Versinnbildlichung der Liebeserfüllung
- 4.2 Blumensäen ins Herz
- 4.3 gebrochene bluomen
- 4.4 Kristes bluomen
- 4.5 Überwindung des Topos bei Reinmar
- 5 Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Potenzialität von „bluomen“ (Blumen) in „Des Minnesangs Frühling“. Das Hauptziel besteht darin, die vielfältigen symbolischen und metaphorischen Funktionen von Blumen in der mittelhochdeutschen Minnelyrik zu ergründen. Die Analyse konzentriert sich auf deren Rolle innerhalb der Jahreszeitentopik und deren Beziehung zur Minnethematik.
- Die symbolische Bedeutung von Blumen im Minnesang
- Die Funktion von Blumen in der Jahreszeitentopik
- Die sprachliche Vielfalt und metaphorische Verwendung von Blumen
- Analyse der Blumen-Symbolik in ausgewählten Minneliedern
- Vergleich der Verwendung von Blumen-Symbolik mit anderen Naturbildern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die Forschungsfrage, die Methodik und den Aufbau der Arbeit. Es erläutert die Bedeutung von Blumen als Symbole in der Dichtung und Liebe und skizziert den Forschungsstand zum Thema Jahreszeitentopik im Minnesang. Die Arbeit konzentriert sich auf "Des Minnesangs Frühling" als Textkorpus und formuliert die zentralen Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen.
2 bluomen als Boten des sumers: Dieses Kapitel liefert eine theoretische Einführung in die Thematik. Es beschreibt Blumen als Bestandteil der Naturbeschreibung und der Jahreszeitentopik im Minnesang. Es wird der gesellschaftliche Kontext des mittelalterlichen Lebens im jahreszeitlichen Wechsel beleuchtet und die Bedeutung der Jahreszeitentopik für die Interpretation der Minnelieder herausgearbeitet. Das Kapitel legt somit das Fundament für die detaillierte Analyse in den folgenden Kapiteln.
3 Exemplarisch: Zur Funktion der bluomen in Dietmars von Eist Ahî, nu kumt uns diu zît (MF 33, 15): Dieses Kapitel präsentiert eine Einzelliedanalyse von Dietmars von Eists Lied. Es untersucht die formalen und inhaltlichen Aspekte des Liedes mit besonderem Fokus auf die verschiedenen Funktionen und sprachlichen Dimensionen der Blumen. Die Analyse prüft, ob die Naturbeschreibung zur Klärung der liedhaften Einheit der Strophen beiträgt und analysiert die verschiedenen Funktionen der Blumen innerhalb der Jahreszeitentopik.
4 bluomen – mehr als nur boten des sumers: Dieses Kapitel geht über die reine Darstellung von Blumen als "Boten des Sommers" hinaus und untersucht deren metaphorische Verwendung in "Des Minnesangs Frühling". Ausgewählte Beispiele illustrieren die vielschichtige Symbolik der Blumen, die über die gängige Jahreszeitentopik hinausgeht. Es wird die Erweiterung und Variation der Blumen-Symbolik innerhalb der Minnelyrik beleuchtet.
Schlüsselwörter
Minnesang, bluomen, Jahreszeitentopik, mittelhochdeutsche Literatur, Blumensymbolik, Metaphorik, Liebeslyrik, Dietmar von Aist, "Des Minnesangs Frühling", sprachliches Potenzial, Naturdarstellung, Minnethematik.
Häufig gestellte Fragen zu "bluomen" im Minnesang
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die sprachliche Bedeutung und die vielfältigen symbolischen und metaphorischen Funktionen von „bluomen“ (Blumen) in der mittelhochdeutschen Minnelyrik, insbesondere in „Des Minnesangs Frühling“. Der Fokus liegt auf der Rolle der Blumen in der Jahreszeitentopik und ihrer Beziehung zur Minnethematik.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine methodisch fundierte Analyse der Sprache und Symbolik. Sie kombiniert eine theoretische Einführung in die Thematik mit einer detaillierten Einzelliedanalyse (Dietmar von Aist, „Ahî, nu kumt uns diu zît“) und einer umfassenden Untersuchung der metaphorischen Verwendung von Blumen in verschiedenen Minneliedern aus „Des Minnesangs Frühling“.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die symbolische Bedeutung von Blumen im Minnesang, ihre Funktion in der Jahreszeitentopik, die sprachliche Vielfalt und metaphorische Verwendung von Blumen, die Analyse der Blumensymbolik in ausgewählten Minneliedern und einen Vergleich der Verwendung von Blumensymbolik mit anderen Naturbildern. Es wird untersucht, ob Blumen lediglich als „Boten des Sommers“ fungieren oder eine tiefere, vielschichtigere Bedeutung besitzen.
Welche Aspekte von „bluomen“ werden im Detail untersucht?
Die Analyse betrachtet „bluomen“ in verschiedenen Kontexten: als Boten des Sommers, als Versinnbildlichung der Liebeserfüllung, als Metapher für „Blumensäen ins Herz“, als Symbol für „gebrochene bluomen“ und „Kristes bluomen“. Es wird auch der Umgang mit diesem Topos bei Reinmar untersucht.
Welche Rolle spielt die Jahreszeitentopik?
Die Jahreszeitentopik spielt eine zentrale Rolle, da die Blumen oft im Kontext der Naturbeschreibung und des jahreszeitlichen Wechsels erscheinen. Die Analyse untersucht, wie die Blumen-Symbolik zur Interpretation der Minnelieder und zur Klärung der liedhaften Einheit der Strophen beiträgt.
Welche konkreten Lieder werden analysiert?
Eine ausführliche Einzelliedanalyse wird an Dietmars von Eists Lied „Ahî, nu kumt uns diu zît (MF 33, 15)“ vorgenommen. Weitere Lieder aus „Des Minnesangs Frühling“ werden exemplarisch herangezogen, um die vielschichtige Symbolik der Blumen zu illustrieren.
Was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen?
Die Arbeit zeigt, dass „bluomen“ im Minnesang weit mehr sind als nur „Boten des Sommers“. Sie besitzen eine vielschichtige symbolische und metaphorische Bedeutung, die eng mit der Minnethematik und dem gesellschaftlichen Kontext des Mittelalters verbunden ist. Die Analyse verdeutlicht die sprachliche Potenzialität von Blumen als aussagekräftige Metaphern und Symbole in der mittelhochdeutschen Lyrik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Minnesang, bluomen, Jahreszeitentopik, mittelhochdeutsche Literatur, Blumensymbolik, Metaphorik, Liebeslyrik, Dietmar von Aist, "Des Minnesangs Frühling", sprachliches Potenzial, Naturdarstellung, Minnethematik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Zur sprachlichen Potenzialität der "bluomen" in "Des Minnesangs Frühling", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1234622