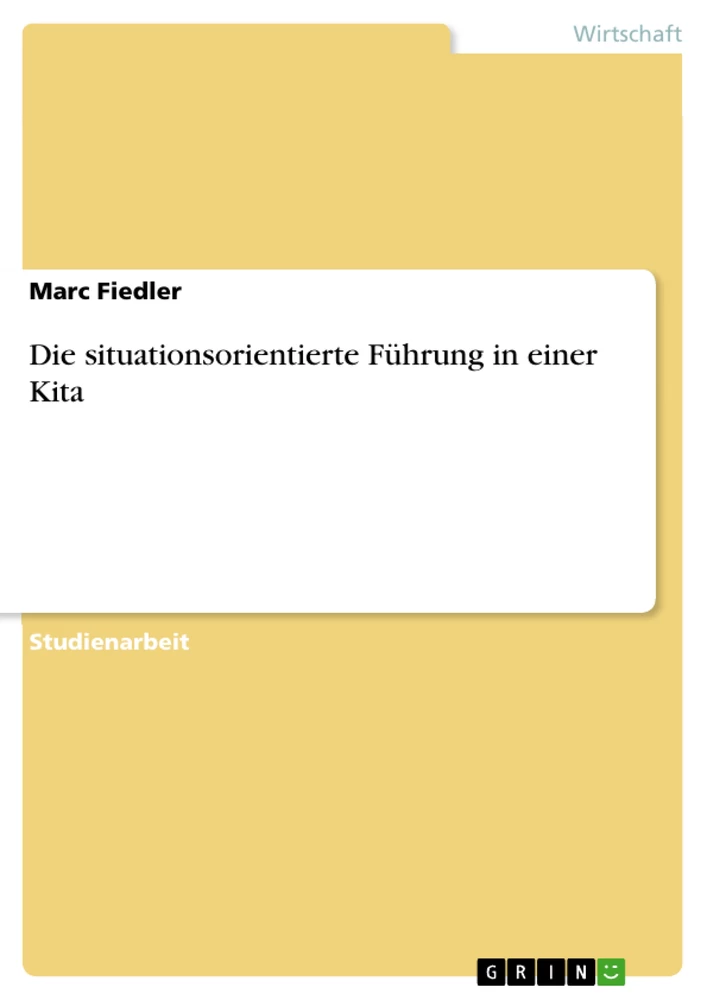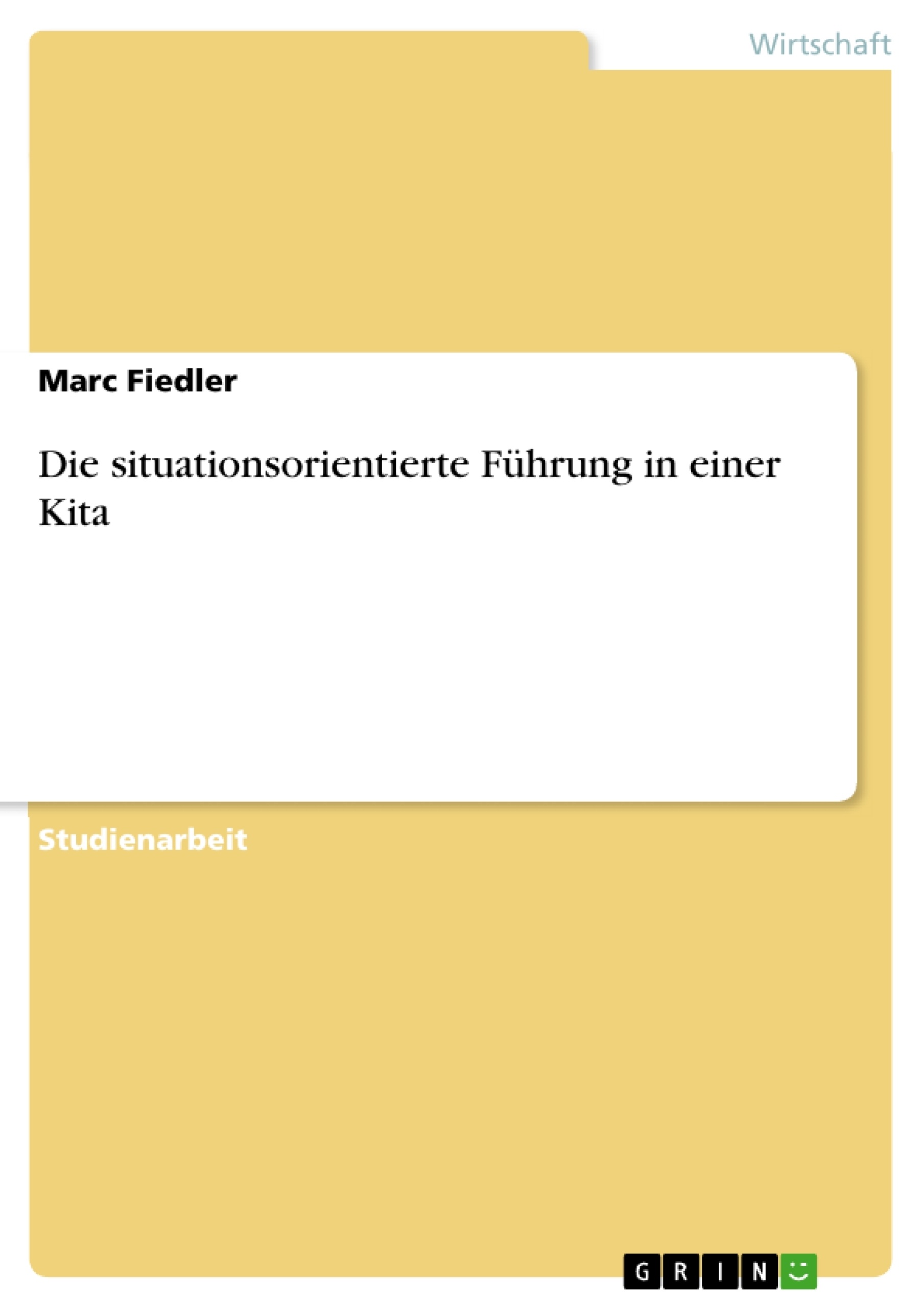Bei der Recherche zu dieser Facharbeit hatte ich mir verschiedene Theorien über Führungsstile angeschaut. Für meine Facharbeit habe ich mir ein Führungsstil-Modell ausgesucht, das ich genauer unter die Lupe nehmen möchte. Ich entschied mich für den situationsorientierten Führungsstil, weil dieser mich am meisten interessiert hat und aus meiner Sicht vermutlich am besten zum Leiten eines Kita-Teams passt.
In meiner Facharbeit wollte ich genauer untersuchen, welche Modelle und Theorien zu einem situationsorientierten Führungsstil gehören und was muss die Kita-Leitung bei der Umsetzung zu beachten hat. Meine Facharbeit habe ich wie nachfolgend beschrieben aufgebaut: Ich werde zunächst mit der Begriffserklärung und Bedeutung der "Führung" beginnen. Um ein Teil meiner Fragestellungen zu beantworten, werde ich danach verschiedene Theorien und Modelle des situationsorientierten Führungsstils behandeln.
Ich entschied mich für 4 sehr bekannte Stille. Dadurch möchte ich die vielfältigen Ausprägungen zeigen. Bei den ersten 3 Theorien und Modellen, das sind die Kontingenztheorie, der Entscheidungsbaum und das 3-D-Modell möchte ich kurz die Entstehung erklären und anschließend die Grundlagen der Theorie erläutern. Dabei soll deutlich
werden, welche Möglichkeiten eine Kita-Leitung hat, einen situationsorientierten Führungsstil für sich zu wählen. Das situative Reifegradmodell werde ich im Anschluss beschreiben und aufzeigen, wie eine Kita-Leitung dieses Modell einsetzen kann, welche Konflikte der Führungsstil mit sich bringt oder welche Vorteile es hat, diesen Stil zu nutzen. Dieses Modell ist das jüngste von den mir vorgestellten Modellen und meiner Ansicht nach, das Modell, welches am ehesten in einer Kita umgesetzt werden kann. Da die Motivation der Mitarbeiter*innen eine wichtige Rolle beim Reifegradmodell einnimmt, werde ich noch kurz drei Motivationstheorien von Maslow, Alderfer und Herzberg vorstellen. Am Schluss werde ich mein Fazit ziehen und alle wichtigen Punkte, die mir später als Leitung helfen werden, nochmal erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition
- Bedeutung von Führung
- Die direkte Führung
- Die indirekte Führung
- Bedeutung des Führungsstiles
- Bedeutung von Führung
- Der situationsorientierte Ansatz
- Die Kontingenztheorie von Fiedler
- Grundlagen von der Kontingenztheorie
- Praxis Beispiel
- Das 3-D Modell von Reddin
- Grundlagen des 3-D Modells
- Die Führungsstile und deren Effektivität nach dem 3-D Modell
- Der Aufgabenstil: Macher oder Autokrat
- Der Beziehungsstil: Förderer oder Gefälligkeitsapostel
- Der Integrationsstil: Integrierer oder Kompromissler
- Der Verfahrensstil: Bürokrat oder Kneifer
- Der Entscheidungsbaum von Vroon und Yetton
- Grundlagen des Entscheidungsbaums
- Praxis Beispiel
- Das Reifegradmodell
- Allgemein
- Reifegrade
- Führung nach dem Reifegradmodell
- Telling
- Selling
- Participating
- Delegating
- Praxis Beispiel
- Möglichen Schwierigkeiten für die Kita-Leitung
- Positive Aspekte für die Kita-Leitung
- Motivation
- Maslow: Bedürfnispyramide
- Alderfer: ERG-Theorie
- Herzberg: Zwei-Faktoren-Theorie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit befasst sich mit der situationsorientierten Führung in einer Kita und analysiert verschiedene Theorien und Modelle, die für diesen Führungsstil relevant sind. Das Ziel ist es, die vielfältigen Ausprägungen des situationsorientierten Führungsstils zu beleuchten und aufzuzeigen, wie Kita-Leitungen diese Modelle in der Praxis einsetzen können.
- Bedeutung und Bedeutung von Führungsstilen in der Kita
- Verschiedene Theorien und Modelle des situationsorientierten Führungsstils
- Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen des situationsorientierten Führungsstils in der Kita
- Bedeutung der Motivation von Mitarbeiter*innen in der Kita
- Praktische Implikationen der Theorien und Modelle für die Kita-Leitung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik der Facharbeit, die Motivation des Autors und den Aufbau der Arbeit.
- Begriffsdefinition: In diesem Kapitel werden die Begriffe „Führung“ und „Führungsstil“ definiert und deren Bedeutung für die Kita-Leitung erklärt.
- Der situationsorientierte Ansatz: Das Kapitel behandelt den situationsorientierten Führungsstil und erläutert seine Grundprinzipien.
- Die Kontingenztheorie von Fiedler: Dieses Kapitel erklärt die Grundlagen der Kontingenztheorie und zeigt anhand eines Praxisbeispiels, wie sie in der Kita angewendet werden kann.
- Das 3-D Modell von Reddin: Hier werden die Grundlagen des 3-D Modells vorgestellt und die verschiedenen Führungsstile und ihre Effektivität erläutert.
- Der Entscheidungsbaum von Vroon und Yetton: Dieses Kapitel erklärt den Entscheidungsbaum und seine Anwendung in der Praxis.
- Das Reifegradmodell: Das Reifegradmodell wird detailliert beschrieben und die verschiedenen Führungsstile sowie deren Einsatzmöglichkeiten in der Kita aufgezeigt.
- Motivation: Das Kapitel beleuchtet die Motivation von Mitarbeiter*innen und behandelt verschiedene Theorien wie die Bedürfnispyramide von Maslow, die ERG-Theorie von Alderfer und die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg.
Schlüsselwörter
Die Facharbeit fokussiert sich auf die Themen Führung, Führungsstil, situationsorientierte Führung, Kita-Leitung, Mitarbeitermotivation und die verschiedenen Theorien und Modelle, die im Zusammenhang mit diesen Themen stehen.
- Arbeit zitieren
- Marc Fiedler (Autor:in), 2022, Die situationsorientierte Führung in einer Kita, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1224174