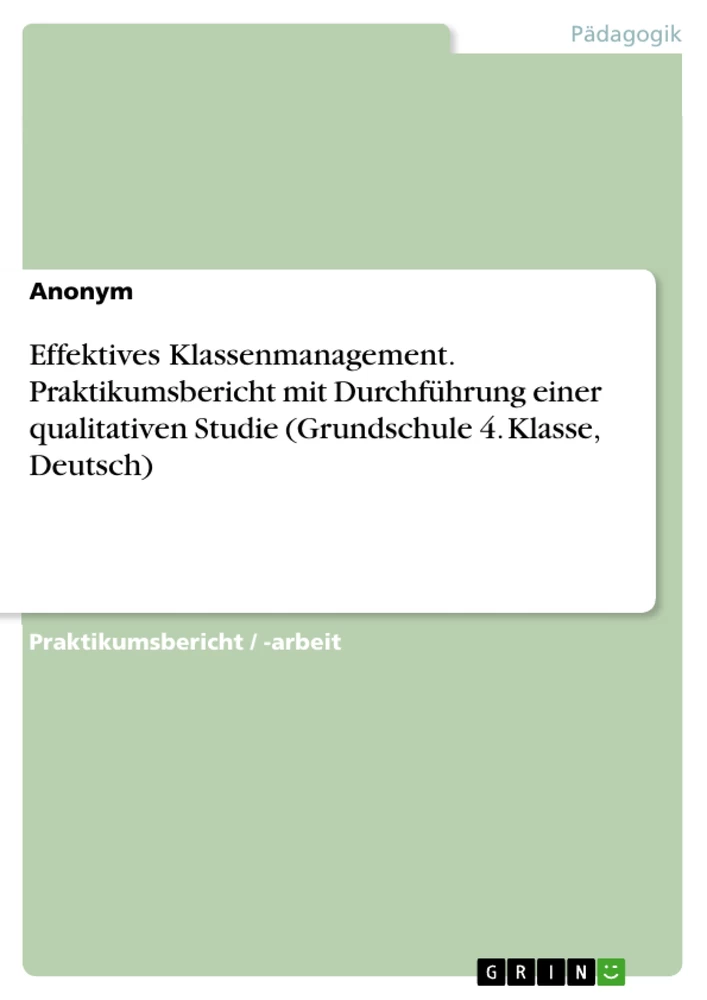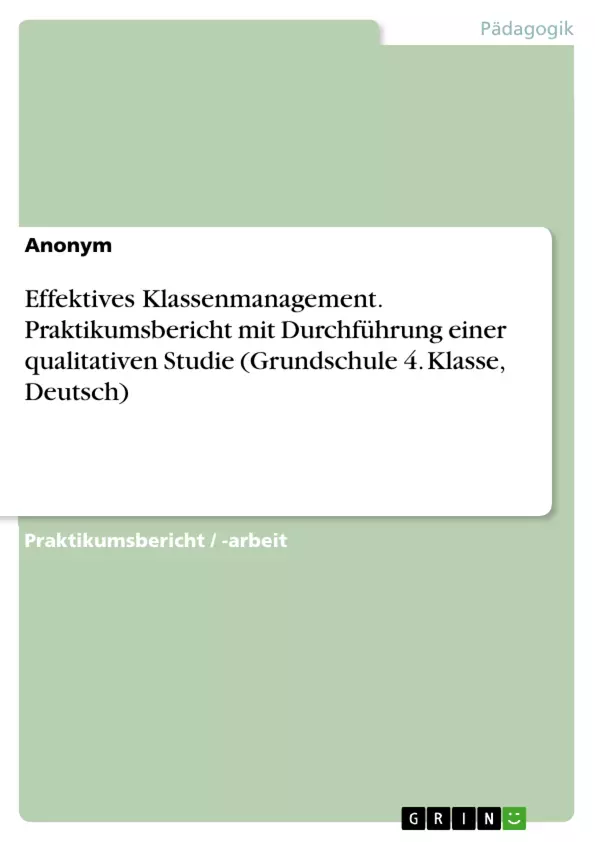Ziel des fünfwöchigen Praktikums, welches größtenteils aus einem Beobachtungsauftrag bestand, war es, durch einen Perspektivwechsel erstmalig in die Rolle des Lehrers schlüpfen zu können und dadurch vertiefende Einblicke in die Institution Schule zu erlangen.
Der erste Teil wird sich mit einer qualitativen Studie befassen, in welcher die Beobachtungsaufgabe bearbeitet wird und somit effektives Klassenmanagement fokussiert. Als theoretische Grundlage sollen hinsichtlich der Beobachtungsanalyse Andreas Wernets Ansätze zur objektiven Hermeneutik und das Verfahren der Sequenzanalyse herangezogen werden. Um ein differenziertes Urteil bilden zu können, werden bezüglich des Klassenmanagements die Studien von Doyle, Ophardt und Thiel, sowie Kounins Techniken der Klassenführung dienen. Den zweiten Themenkomplex bildet die Ausarbeitung der eigenen Unterrichtsstunde, insbesondere hinsichtlich der Planung, Durchführung und Auswertung der Inhalte und des Stundenverlaufs.
Im dritten Teil soll eine detaillierte Selbstreflexion der eigenen Rolle als Lehrkraft folgen. Hier werde ich Themenbereiche wie den Umgang mit Schüler*innen, dem Kollegium, der Arbeitsbelastung oder auch Störungen in den Mittelpunkt stellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Unterrichtsbeobachtung – Erstellen einer quantitativen Studie
- Vorarbeiten und die erziehungswissenschaftliche Fragestellung
- Das methodische Vorgehen
- Die Sequenzanalyse nach Wernet
- Die regelgeleitete Auswertung der Beschreibungen (sequentiell)
- Die theoriegestützte Auswertung der Befunde
- Klassenmanagement – Theoretische Grundlagen
- Bezug zu den Fallbeispielen
- Die kritische Reflexion der verwendeten theoretischen Ansätze
- Handlungsalternativen im Hinblick auf eigenes zukünftiges Handeln
- Der eigene Unterricht- Deutschstunde
- Planung
- Bedingungsanalyse
- Sachanalyse
- Didaktisch-methodische Planung
- Unterrichtsverlaufsplan (tabellarisch)
- Durchführung
- Auswertung
- Verlauf
- Stundenergebnisse
- Rückmeldung durch die Lehrkraft
- Die Reflexion der eigenen Lehrer*innenrolle
- Planung
- Reflexion der eigenen Rolle
- Umgang mit Schüler*innen
- Umgang mit dem Kollegium
- Umgang mit Störungen und Konflikten
- Umgang mit der Arbeitsbelastung
- Selbsteinschätzung des eigenen Lern- und Entwicklungsbedarfs
- Anhang
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Schulpraktikum in einer Grundschule, wobei der Fokus auf der Unterrichtsbeobachtung und dem eigenen Deutschunterricht liegt. Ziel ist es, die Rolle des Lehrers und die Herausforderungen des Klassenmanagements zu beleuchten, sowie die eigenen Kompetenzen in der Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht zu reflektieren.
- Klassenmanagement: Analyse von Methoden und deren Auswirkungen auf die Lernatmosphäre
- Beobachtung und Sequenzanalyse nach Wernet: Einsetzen eines wissenschaftlichen Verfahrens zur Analyse von Unterrichtsgeschehen
- Selbstreflexion der eigenen Lehrer*innenrolle: Umgang mit Schüler*innen, Kollegium und Störungen
- Planung und Durchführung eigener Unterrichtseinheiten: Entwicklung und Umsetzung einer Deutschstunde
- Entwicklung der eigenen Kompetenzen im Bereich der Unterrichtsgestaltung und -auswertung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Schulpraktikums dar und erläutert die Motivation, das Praktikum an einer Grundschule zu absolvieren. Sie definiert die Ziele und Erwartungen sowie die Fragestellung der Arbeit.
Im zweiten Kapitel wird die Unterrichtsbeobachtung analysiert. Die Autorin beschreibt ihre Vorgehensweise bei der Anwendung der Sequenzanalyse nach Wernet und erläutert die theoretischen Grundlagen des Klassenmanagements, die sie zur Analyse des beobachteten Unterrichts nutzt.
Das dritte Kapitel fokussiert sich auf die Planung, Durchführung und Auswertung der eigenen Deutschstunde. Es werden die verschiedenen Phasen der Unterrichtsgestaltung sowie die Ergebnisse der Stunde und die Rückmeldung durch die Lehrkraft detailliert dargestellt.
Im vierten Kapitel reflektiert die Autorin ihre eigene Rolle als Lehrkraft und beleuchtet Themen wie den Umgang mit Schüler*innen, Kollegium, Störungen und der Arbeitsbelastung. Sie analysiert ihre eigenen Stärken und Schwächen und benennt ihren individuellen Lern- und Entwicklungsbedarf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Schulpraktikum, Unterrichtsbeobachtung, Klassenmanagement, Sequenzanalyse, Deutschunterricht, Selbstreflexion und Lehrkräftekompetenzen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Effektives Klassenmanagement. Praktikumsbericht mit Durchführung einer qualitativen Studie (Grundschule 4. Klasse, Deutsch), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1217870