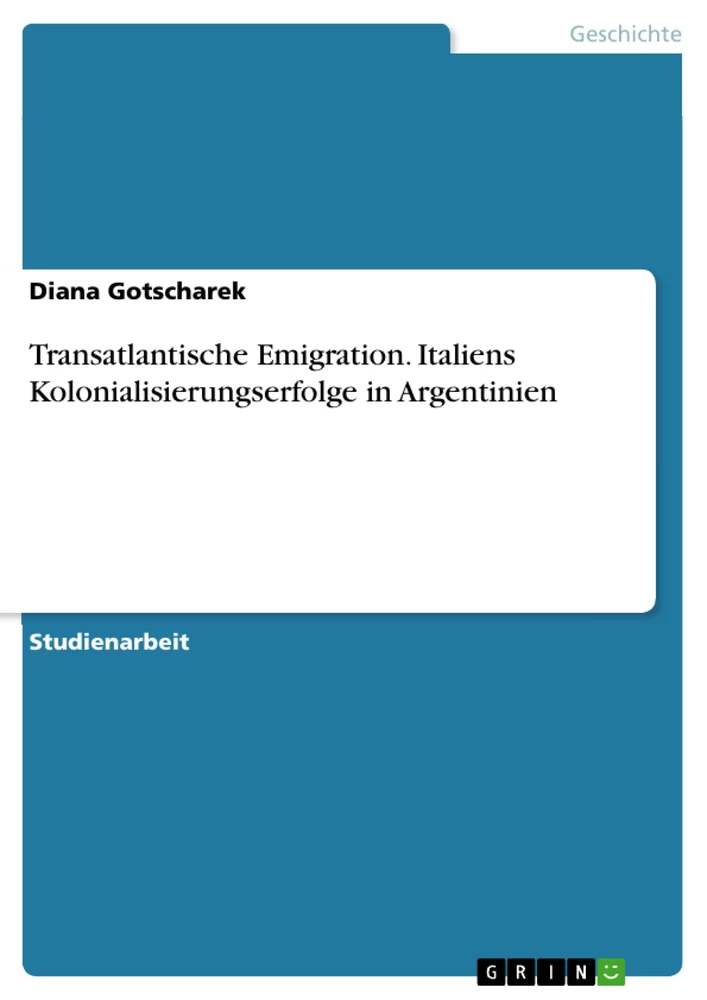Diese Arbeit zeigt die Bemühungen Italiens während der transatlantischen Emigration auf. Sie zeigt Statistiken und bemüht sich darum zu erklären, weshalb der italienische Staat seine Staatsangehörigkeitsrechte über den Atlantik hinaus erweiterte. Dabei soll folgende Frage beantwortet werden: Kann man bei der Emigration von Italiener nach Argentinien überhaupt von Kolonialisierung sprechen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Stadtentwicklung zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- 2 Transatlantische Emigration
- 2.1 Statistische Zahlen der italienischen Auswanderer
- 2.2 Wer waren die Auswanderer?
- 2.3 Der Umgang Argentiniens mit den Einwanderern
- 2.4 Die Schaffung eines nationalen Zugehörigkeitsgefühls.
- 3 Das italienische Staatsangehörigkeitsrecht.
- 3.1 Auf dem Weg zur Einigung.
- 3.2 Die Massenemigration bis 1914.
- 3.3 Das legge Crispi oder das Gesetz der sozialen Gerechtigkeit (1876 - 1896) ...
- 3.4 Berufliche Situation der Emigranten in Argentinien
- 3.5 Zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1912
- 4 Fazit.........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der transatlantischen Emigration aus Italien nach Argentinien im 19. Jahrhundert. Sie untersucht die Statistiken der italienischen Auswanderer und analysiert die Gründe für die Entscheidung des italienischen Staates, seine Staatsangehörigkeitsrechte auch über den Atlantik hinaus auszudehnen. Ein zentraler Aspekt ist die Frage, ob von einer Kolonialisierung der argentinischen Gesellschaft durch die italienischen Einwanderer gesprochen werden kann.
- Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert als Folge der Industrialisierung
- Statistische Daten und Analyse der italienischen Auswanderung
- Umgang Argentiniens mit den italienischen Einwanderern
- Entwicklung des italienischen Staatsangehörigkeitsrechts im Kontext der Auswanderung
- Frage nach der möglichen Kolonialisierung Argentiniens durch italienische Einwanderer
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert im Kontext der Industrialisierung. Es wird erläutert, wie die Wanderungsbewegungen und die Veränderungen in der städtischen Raumstruktur die Entwicklung der europäischen Städte beeinflussten. Das zweite Kapitel widmet sich der transatlantischen Emigration aus Italien nach Argentinien. Hierbei werden statistische Daten der Auswanderung präsentiert und der Umgang Argentiniens mit den Einwanderern beleuchtet. Zudem wird der Prozess der Schaffung eines nationalen Zugehörigkeitsgefühls in Argentinien im Zusammenhang mit der Einwanderung analysiert. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf das italienische Staatsangehörigkeitsrecht und dessen Veränderung im Kontext der Auswanderung. Es beleuchtet die Entwicklung Italiens zur Unabhängigkeit, die Massenemigration und die ersten Gesetze zum Staatsangehörigkeitsrecht. Im Fokus steht die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1912.
Schlüsselwörter
Transatlantische Emigration, Italien, Argentinien, Kolonialisierung, Staatsangehörigkeitsrecht, Stadtentwicklung, Industrialisierung, Migration, Nationalgefühl, Gesetz der sozialen Gerechtigkeit, legge Crispi.
- Arbeit zitieren
- Diana Gotscharek (Autor:in), 2019, Transatlantische Emigration. Italiens Kolonialisierungserfolge in Argentinien, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1216670