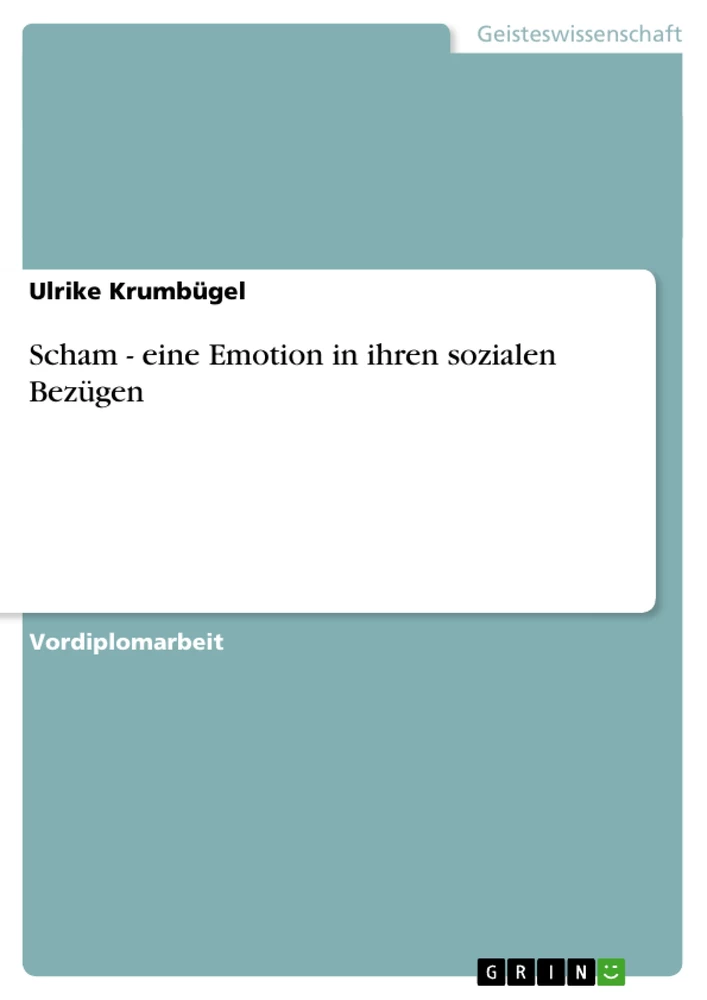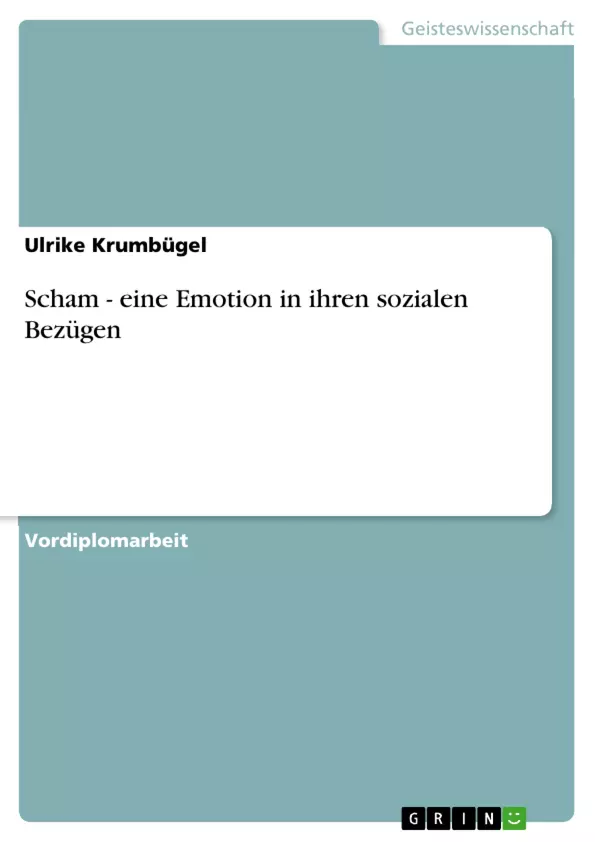[...]
Die Annäherung an den Begriff Scham geht zuerst vom Menschen selbst aus, von
der Frage nach dem sich schämenden Subjekt: Was für ein Wesen ist der Mensch, dass er sich
schämen kann und schämt? Was ist Besonderheit der menschlichen Existenzweise? Dieser
Frage werde ich mich in 2.1 widmen, um danach (2.2) eine erste Einordnung der Scham in
einen sozialen Zusammenhang vorzunehmen. Nach der Klärung der allgemeinen
Bedingungen der Scham, die sich in der spezifischen (sozialen) Existenzweise des Menschen
finden, werde ich mich den allgemeinen Merkmalen des Schamaffekts zuwenden (3.), die auf
seiner Unterscheidung von anderen emotionalen Zuständen bestehen und sich in spezifischen
emotionalen Empfindungen, physiologischen Besonderheiten und veränderten Verhaltensweisen
konkretisieren, die für den Schamaffekt zwar nicht bindend sind, ihn aber in ihren
individuellen Abstufungen durchaus charakterisieren. Weiterhin werde ich auf die der Scham
innewohnenden Funktionen eingehen (4.) und mich dann der Scham als sozialem Phänomen
zuzuwenden (5.), um ihre Abhängigkeit von gesellschaftlichen Normen (5.1) und der
Anwesenheit anderer Menschen (5.2), sowie ihren potentiell sozialen Charakter (5.3) zu
erläutern. Auf die individuelle in sozialen Zusammenhängen geschehende Beeinflussbarkeit
des Schamempfindens unter dem Einfluss der Erziehung werde ich in 6. eingehen, um letztendlich die Unterschiede im Schamempfinden von verschiedenen Personen unter dem
Gesichtspunkt des sozialen Merkmals Status zu betrachten (7.). Ziel dieser Hausarbeit ist es
damit, das Phänomen Scham unter Berücksichtigung seiner individuellen Komponenten in
seinen allgemeinen sozialen Bezügen darzustellen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Voraussetzungen für das Auftreten des Schamaffekts
- 2.1 Die menschliche Existenzweise
- 2.2 Die Fähigkeit zur Selbstobjektivierung
- 3. Merkmale des Schamaffekts
- 4. Funktionen der Scham
- 5. Scham als soziales Phänomen
- 5.1 Scham im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Normen
- 5.2 Die Bedeutung der Anderen
- 5.3 Scham für andere und Kollektivscham
- 6. Scham und Beschämung in der Erziehung
- 7. Soziale Merkmale als Schamanlass - Status und Scham
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen der Scham, indem sie die individuellen Komponenten der Scham in ihren sozialen Bezügen darstellt. Sie beleuchtet die Voraussetzungen für das Auftreten von Scham, die Merkmale des Schamaffekts und seine Funktionen. Ein zentrales Anliegen ist die Betrachtung der Scham als soziales Phänomen.
- Die menschliche Existenzweise als Voraussetzung für Scham
- Die Rolle der Selbstobjektivierung im Schamgefühl
- Scham im Kontext gesellschaftlicher Normen und sozialer Interaktion
- Der Einfluss von Erziehung auf das Schamempfinden
- Der Zusammenhang zwischen sozialem Status und Scham
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung führt in das Thema Scham ein und skizziert den Ansatz der Arbeit, der sich auf die Verbindung zwischen individueller Erfahrung und sozialen Kontexten konzentriert. Sie hebt die Variabilität von Schamanlässen und -inhalten hervor.
Kapitel 2 (Voraussetzungen für das Auftreten des Schamaffekts): Dieses Kapitel untersucht die philosophischen Ansätze von Max Scheler und Jean-Paul Sartre zur Scham. Scheler betont die innere Zerrissenheit des Menschen zwischen Geist und Leib als Grundlage des Schamgefühls. Sartre hingegen fokussiert auf die Rolle des "Blicks des Anderen" und die Fähigkeit zur Selbstobjektivierung als Voraussetzungen für Scham.
Kapitel 3 (Merkmale des Schamaffekts): Dieses Kapitel (und die folgenden, die hier nicht explizit zusammengefasst werden) wird sich voraussichtlich mit den spezifischen Merkmalen des Schamaffekts befassen, wie sie sich in emotionalen Empfindungen, physiologischen Reaktionen und Verhaltensweisen äußern.
Kapitel 4 (Funktionen der Scham): Hier werden die verschiedenen Funktionen der Scham untersucht und erläutert.
Kapitel 5 (Scham als soziales Phänomen): Dieses Kapitel analysiert die Abhängigkeit der Scham von gesellschaftlichen Normen, der Anwesenheit anderer und ihrem potentiell sozialen Charakter.
Kapitel 6 (Scham und Beschämung in der Erziehung): Dieses Kapitel wird sich mit dem Einfluss der Erziehung auf die Entwicklung und das Ausmaß des Schamempfindens auseinandersetzen.
Kapitel 7 (Soziale Merkmale als Schamanlass - Status und Scham): Dieses Kapitel wird die Unterschiede im Schamempfinden verschiedener Personen im Hinblick auf ihren sozialen Status untersuchen.
Schlüsselwörter
Scham, Schamaffekt, Selbstobjektivierung, soziale Normen, gesellschaftliche Einflüsse, Erziehung, sozialer Status, Max Scheler, Jean-Paul Sartre, Existenzweise, Identität.
- Arbeit zitieren
- Ulrike Krumbügel (Autor:in), 2006, Scham - eine Emotion in ihren sozialen Bezügen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/121649