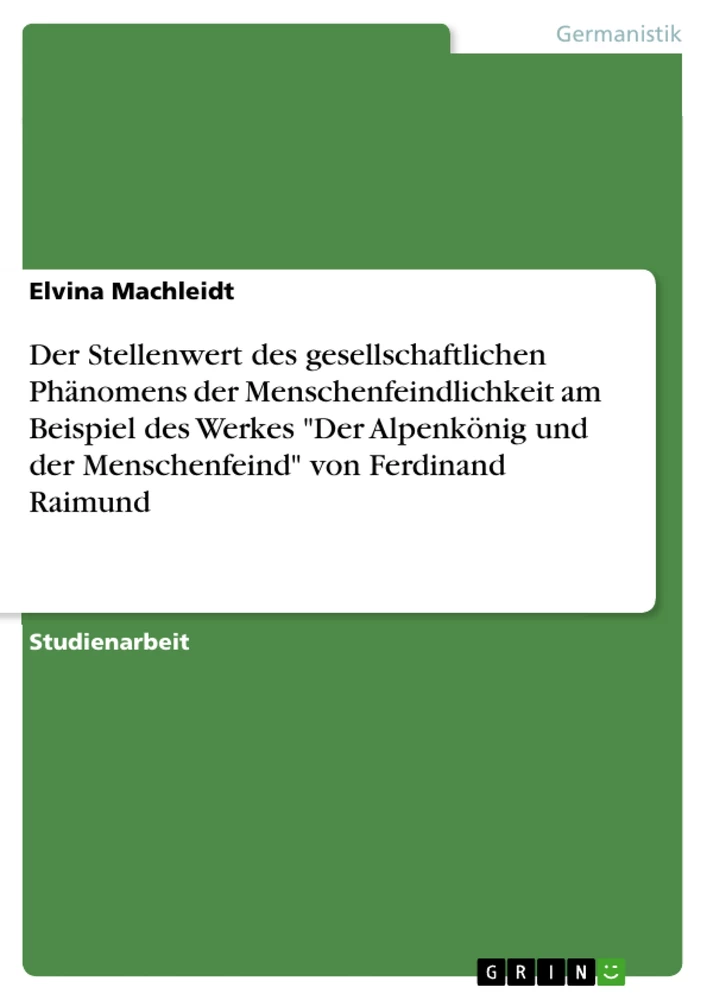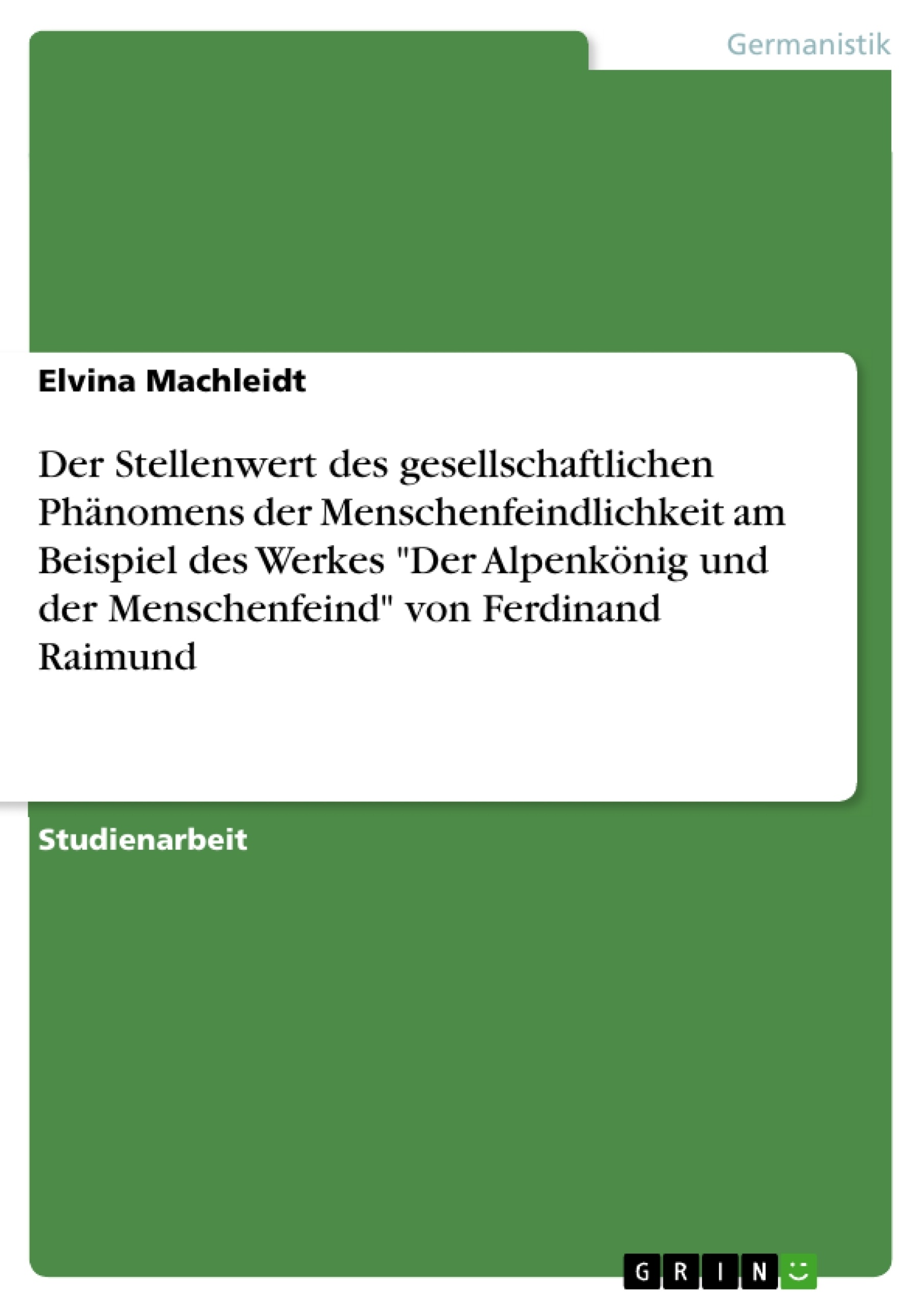Im Sinne einer Feststellung über die Beschaffenheit der Komödie handelt es sich beim im Rahmen dieser Seminararbeit behandelten Werk "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" von Ferdinand Raimund um eines mit zahlreichen komödiantischen Elementen, die auch in der Bearbeitung negativ behafteter Themenkomplexe zum Einsatz kommen. So wird es auf den folgenden Seiten in erster Linie um das sowohl historisch relevante als auch allgegenwärtige Phänomen der Menschenfeindlichkeit gehen, deren Motive bereits hochrangige Schriftsteller wie etwa Raimund und Molière beschäftigten, aber bedauerlicherweise auch in die Gegenwart hineinreichen.
Im Zuge der vorliegenden Seminararbeit werden zunächst Rolle und Stellenwert der Komödie in der neudeutschen Literatur des 19. Jahrhunderts in den Mittelpunkt gestellt, ehe auf das von Ferdinand Raimund verfasste Werk "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" Bezug genommen wird. Einer kurzen Beschreibung der Geschichte folgt eine umfassende Untersuchung des Motivs der Menschenfeindlichkeit, die Raimund in erster Linie im Kontext des Staatsbankrotts des Jahres 1811 beschäftigt. Diesem Phänomen wird aber nicht lediglich im historischen Längsschnitt erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt; ergänzend zu einem kurzen Vergleich in der Bearbeitung zwischen Raimund und früheren Generationen von Schriftstellern wie etwa von Shakespeare oder Molière werden auch wesentliche Entstehungsfaktoren der Menschenfeindlichkeit skizziert und entsprechende Einbettungen in den geschichtlichen Kontext vorgenommen.
Die Umsetzung der hier beschriebenen Vorgehensweise dient vor allem der Beantwortung der Forschungsfragen, welchen Einfluss das Motiv der Menschenfeindlichkeit auf dessen literarische Verarbeitung Raimunds im Rahmen des Werkes "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" hat sowie welche Parallelen sich zwischen historischer und kontemporärer Bedeutung dieses Phänomens herausarbeiten lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellungen
- 2. Die Komödie in der neudeutschen Literatur des 19. Jahrhunderts
- 3. Das Werk „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“
- 3.1 Exkurs: Der österreichische Staatsbankrott des Jahres 1811
- 3.2 Handlung, Bedeutung, Interpretation
- 4. Das Motiv der Menschenfeindlichkeit
- 4.1 Die Menschenfeindlichkeit bei Raimund und anderen Autoren
- 4.2 Wichtige Entstehungsfaktoren der Menschenfeindlichkeit
- 5. Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit untersucht das Phänomen der Menschenfeindlichkeit im Kontext von Ferdinand Raimunds Werk „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“. Die Arbeit zielt darauf ab, den Stellenwert der Menschenfeindlichkeit in Raimunds Werk zu analysieren und die historischen und gesellschaftlichen Ursachen dieses Motivs aufzuzeigen.
- Rolle und Stellenwert der Komödie in der neudeutschen Literatur des 19. Jahrhunderts
- Das Motiv der Menschenfeindlichkeit bei Raimund und anderen Autoren
- Die Bedeutung des Staatsbankrotts des Jahres 1811 für Raimunds Werk
- Die Entstehung und Verbreitung des Motivs der Menschenfeindlichkeit im historischen Kontext
- Parallelen zwischen historischer und zeitgenössischer Bedeutung des Motivs der Menschenfeindlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung und Fragestellungen - Dieses Kapitel führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt die Forschungsfragen vor. Dabei wird die Bedeutung des Komischen in der Literatur, insbesondere im Kontext der Komödie, hervorgehoben.
- Kapitel 2: Die Komödie in der neudeutschen Literatur des 19. Jahrhunderts - Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Komödie in der neudeutschen Literatur. Es werden die spezifischen Eigenschaften des Komischen sowie die historische und gesellschaftliche Entwicklung der Komödie im 19. Jahrhundert beleuchtet.
- Kapitel 3: Das Werk „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ - Dieses Kapitel stellt Raimunds Werk „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ vor. Es beleuchtet die Handlung, Bedeutung und Interpretation des Werkes und bietet einen Exkurs zum österreichischen Staatsbankrott des Jahres 1811, der eine wichtige Rolle im Werk spielt.
- Kapitel 4: Das Motiv der Menschenfeindlichkeit - Dieses Kapitel untersucht das Motiv der Menschenfeindlichkeit im Werk Raimunds und bei anderen Autoren. Es beleuchtet die wichtigen Entstehungsfaktoren der Menschenfeindlichkeit, ihre historische Einbettung und die Bedeutung in der literarischen Verarbeitung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Seminararbeit sind: Komödie, neudeutsche Literatur, Ferdinand Raimund, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“, Menschenfeindlichkeit, Staatsbankrott, historische und gesellschaftliche Ursachen, literarische Verarbeitung, 19. Jahrhundert.
- Arbeit zitieren
- Elvina Machleidt (Autor:in), 2018, Der Stellenwert des gesellschaftlichen Phänomens der Menschenfeindlichkeit am Beispiel des Werkes "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" von Ferdinand Raimund, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1215312