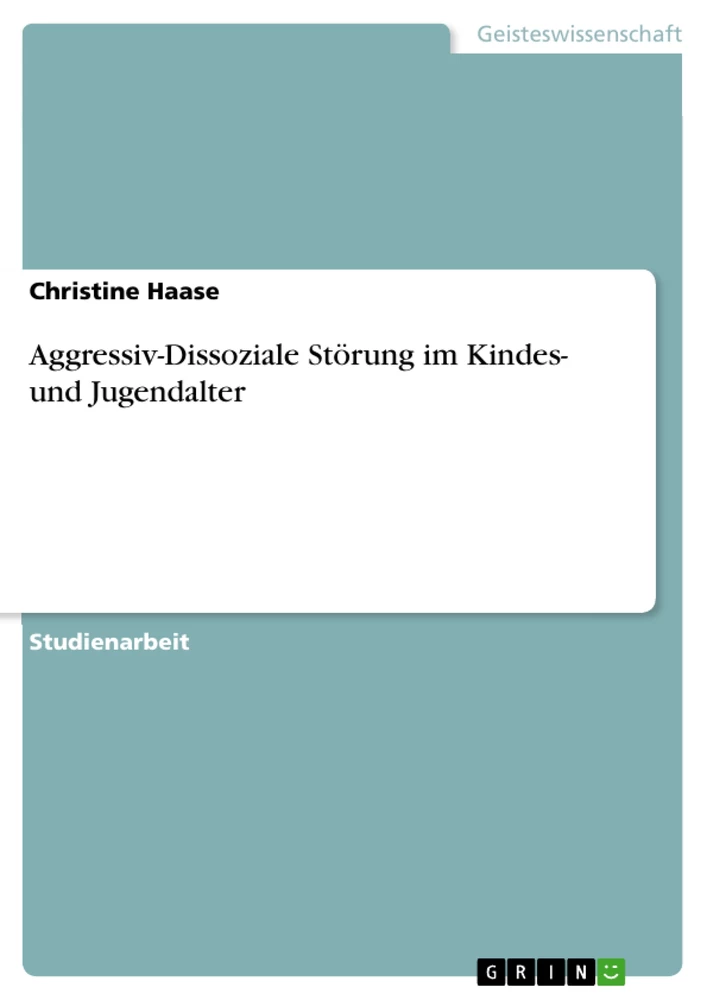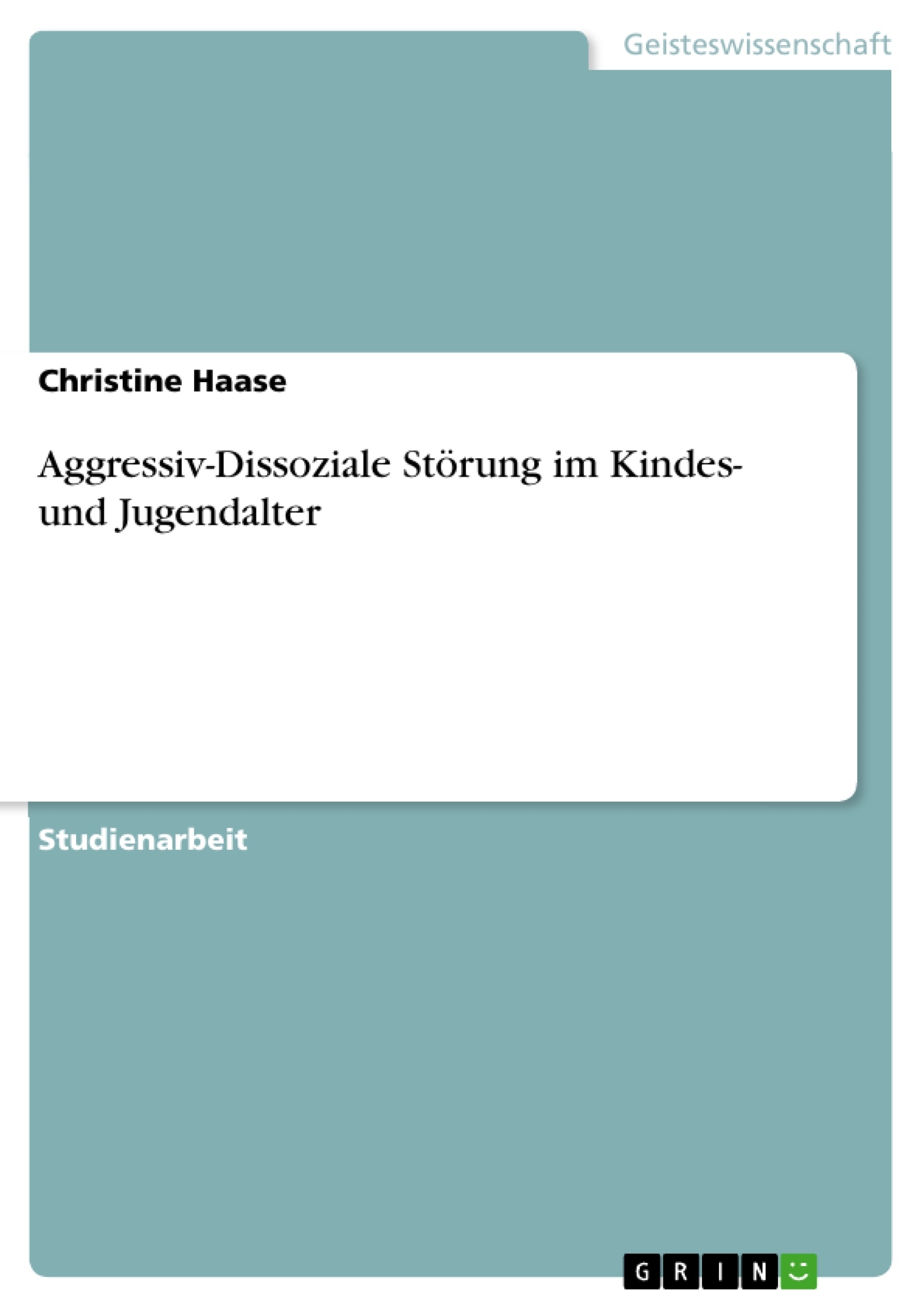Mit dem Eintritt eines Kindes in den Kindergarten, kommen auf dieses verschiedene neue Situationen zu, die bewältigt werden müssen. Der - im Optimalfall - schützende Rahmen der Familie ist in der Betreuung im Kindergarten nicht mehr gegeben. Das Kind muss somit in Anpassung an die neue Umgebung die eigene soziale Kompetenz erweitern und festigen. Zu den Entwicklungsaufgaben, die im Kindergartenalter bewältigt werden müssen, zählen neben dem Erlangen einer gewissen Selbstständigkeit in den profanen Dingen des Alltags, wie beispielsweise das selbstständige Anziehen nach dem Mittagsschlaf ganz klar auch die Sprachentwicklung und die Fähigkeit der klaren Ausformulierung eigener Bedürfnisse.
Diese kognitiven Ausdifferenzierungen fördern nach Koglin und Petermann die Aufmerksamkeitsleistung und Merkfähigkeit des Kindes und tragen zu einer verbesserten Phantasietätigkeit bei, die dem Kind in Spielsituationen zugute kommt. Einige Kinder jedoch scheinen diesen neuen Anforderungen jedoch nicht gewachsen zu sein oder ihnen gelingt die Anpassung an die neue Lebenssituation nicht so leicht, wie es bei anderen Kinder der Fall ist. Sie fallen durch ein schwieriges Temperament auf und stellen Erzieherinnen und Eltern vor Herausforderungen, die viel Geduld und Verständnis erfordern, jedoch mit pädagogischem Geschick durchaus gefördert werden können. Ein kleiner Teil erfordert jedoch so viel Aufmerksamkeit, dass dies in einer normalen Betreuung kaum zu schaffen ist. Diese Kinder können unter einem der im Folgenden dargestellten Störungen im Kindes- und Jugendalter gehören und sollten so früh wie möglich entsprechend ihrer Defizite gefördert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. DIE AGGRESSIV-DISSOZIALE VERHALTENSSTÖRUNG
- 1.1 Diagnostik nach DSM-IV und ICD-10
- 1.2 Komorbide Störungen
- 1.3 Ursachen für die Entwicklung aggressiver Verhaltensmuster
- 2. HYPERKINETISCHE STÖRUNGEN – ADHS
- 2.1 Diagnostik nach DSM-IV und ICD-10
- 2.2 Komorbide Störungen
- 2.3 Ursachen für die Entstehung einer hyperkinetischen Störung
- 3. THERAPIEFORMEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit aggressiv-dissozialen Verhaltensstörungen und ADHS im Kindes- und Jugendalter. Ziel ist es, die Diagnostik, Komorbiditäten und Ursachen dieser Störungen zu erläutern und einen Überblick über mögliche Therapieformen zu geben.
- Diagnostik aggressiv-dissozialer Verhaltensstörungen und ADHS nach DSM-IV und ICD-10
- Komorbide Störungen im Zusammenhang mit aggressiv-dissozialen Verhaltensstörungen und ADHS
- Ursachen für die Entwicklung aggressiver Verhaltensmuster und ADHS
- Unterschiedliche Formen aggressiven Verhaltens (offen, verdeckt, reaktiv, proaktiv)
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in aggressiven Verhaltensweisen
Zusammenfassung der Kapitel
1. DIE AGGRESSIV-DISSOZIALE VERHALTENSSTÖRUNG: Dieses Kapitel behandelt die aggressiv-dissoziale Verhaltensstörung, eine externalisierende Verhaltensstörung, die vorwiegend bei Kindern und Jugendlichen auftritt. Es wird zwischen dissozialem Verhalten (Verletzung sozialer Regeln) und aggressivem Verhalten (Schaden an Personen oder Objekten) unterschieden. Die Bedeutung der Unterscheidung verschiedener Aggressionsformen (offen/verdeckt, reaktiv/proaktiv) für die Diagnostik und Therapie wird hervorgehoben. Die Langzeitprognose wird als relativ schlecht beschrieben, was die Bedeutung frühzeitiger Intervention unterstreicht. Das Kapitel betont die Herausforderungen der Diagnose aufgrund der Heterogenität aggressiven Verhaltens und der Notwendigkeit differenzierter diagnostischer Verfahren. Es werden verschiedene Formen aggressiven Verhaltens detailliert beschrieben, darunter offene und verdeckte Aggression sowie reaktive und proaktive Aggression. Zusätzlich wird auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Ausprägung aggressiven Verhaltens eingegangen, mit dem Hinweis auf die Bedeutung von direkter/körperlicher vs. indirekter/manipulativer Aggression für Jungen und Mädchen.
2. HYPERKINETISCHE STÖRUNGEN – ADHS: Dieses Kapitel befasst sich mit hyperkinetischen Störungen, insbesondere ADHS. Ähnlich wie im vorherigen Kapitel werden diagnostische Kriterien nach DSM-IV und ICD-10 erläutert, sowie komorbide Störungen betrachtet. Ein Schwerpunkt liegt auf den Ursachen der Entstehung von ADHS. Im Gegensatz zum ersten Kapitel, welches sich detailliert mit verschiedenen Formen aggressiven Verhaltens auseinandersetzt, konzentriert sich dieses Kapitel auf die spezifischen Herausforderungen der Diagnose und des Verständnisses von ADHS. Es liefert einen Überblick über die vielschichtigen Ursachen dieser Störung und bildet damit eine wichtige Grundlage für ein ganzheitliches Verständnis der Problematik im Kindes- und Jugendalter.
3. THERAPIEFORMEN: Dieses Kapitel (lediglich der Titel ist gegeben) würde voraussichtlich verschiedene Therapieansätze für aggressiv-dissoziale Verhaltensstörungen und ADHS vorstellen und diskutieren. Es wäre zu erwarten, dass verschiedene therapeutische Strategien im Detail beschrieben und ihre Wirksamkeit und Anwendbarkeit im Kontext der jeweiligen Störung evaluiert werden. Die Zusammenfassung dieses Kapitels würde die verschiedenen Therapieansätze gegenüberstellen und deren jeweilige Vor- und Nachteile aufzeigen. Ein möglicher Schwerpunkt könnte auf der Integration verschiedener Therapieformen liegen, um ein möglichst umfassendes und effektives Behandlungskonzept zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Aggressiv-dissoziale Verhaltensstörung, ADHS, Diagnostik, DSM-IV, ICD-10, Komorbidität, Ursachen, Aggression, Therapie, Kinder, Jugendliche, Entwicklung, Sozialverhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aggressiv-dissoziale Verhaltensstörungen und ADHS im Kindes- und Jugendalter
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit aggressiv-dissozialen Verhaltensstörungen und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) im Kindes- und Jugendalter. Sie behandelt die Diagnostik nach DSM-IV und ICD-10, komorbide Störungen, die Ursachen der Störungen und einen Überblick über mögliche Therapieformen. Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Formen aggressiven Verhaltens (offen, verdeckt, reaktiv, proaktiv) und geht auf geschlechtsspezifische Unterschiede ein.
Welche Störungen werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Hauptstörungen: aggressiv-dissoziale Verhaltensstörungen und ADHS. Im Kontext der aggressiv-dissozialen Verhaltensstörungen wird zwischen dissozialem (Verletzung sozialer Regeln) und aggressivem Verhalten (Schaden an Personen oder Objekten) unterschieden. Bei ADHS liegt der Fokus auf den spezifischen Herausforderungen der Diagnose und des Verständnisses dieser Störung.
Wie wird die Diagnostik behandelt?
Die Diagnostik nach DSM-IV und ICD-10 für sowohl aggressiv-dissoziale Verhaltensstörungen als auch ADHS wird detailliert erläutert. Die Arbeit hebt die Heterogenität aggressiven Verhaltens hervor und betont die Notwendigkeit differenzierter diagnostischer Verfahren.
Welche Komorbiditäten werden berücksichtigt?
Die Arbeit beschreibt komorbide Störungen, die im Zusammenhang mit aggressiv-dissozialen Verhaltensstörungen und ADHS auftreten können. Dies unterstreicht die Komplexität dieser Störungen und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung.
Welche Ursachen werden für die Störungen genannt?
Die Arbeit untersucht die Ursachen für die Entwicklung aggressiver Verhaltensmuster und ADHS. Sie liefert einen Überblick über die vielschichtigen Ursachen dieser Störungen, um ein umfassendes Verständnis der Problematik zu ermöglichen.
Welche Therapieformen werden besprochen?
Obwohl ein separates Kapitel zu Therapieformen geplant ist (jedoch nur der Titel gegeben ist), deutet der Text darauf hin, dass verschiedene Therapieansätze für aggressiv-dissoziale Verhaltensstörungen und ADHS vorgestellt und diskutiert werden sollen, inklusive einer Evaluierung der Wirksamkeit und Anwendbarkeit im Kontext der jeweiligen Störung. Die Integration verschiedener Therapieformen für ein umfassendes Behandlungskonzept soll ebenfalls thematisiert werden.
Welche Arten von Aggression werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Formen aggressiven Verhaltens: offene und verdeckte Aggression sowie reaktive und proaktive Aggression. Die Bedeutung dieser Unterscheidung für Diagnostik und Therapie wird hervorgehoben.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede?
Ja, die Arbeit weist auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Ausprägung aggressiven Verhaltens hin, insbesondere auf den Unterschied zwischen direkter/körperlicher vs. indirekter/manipulativer Aggression bei Jungen und Mädchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Aggressiv-dissoziale Verhaltensstörung, ADHS, Diagnostik, DSM-IV, ICD-10, Komorbidität, Ursachen, Aggression, Therapie, Kinder, Jugendliche, Entwicklung, Sozialverhalten.
Wie ist die Langzeitprognose?
Für aggressiv-dissoziale Verhaltensstörungen wird eine relativ schlechte Langzeitprognose beschrieben, was die Bedeutung frühzeitiger Intervention unterstreicht.
- Arbeit zitieren
- Christine Haase (Autor:in), 2007, Aggressiv-Dissoziale Störung im Kindes- und Jugendalter, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1214878