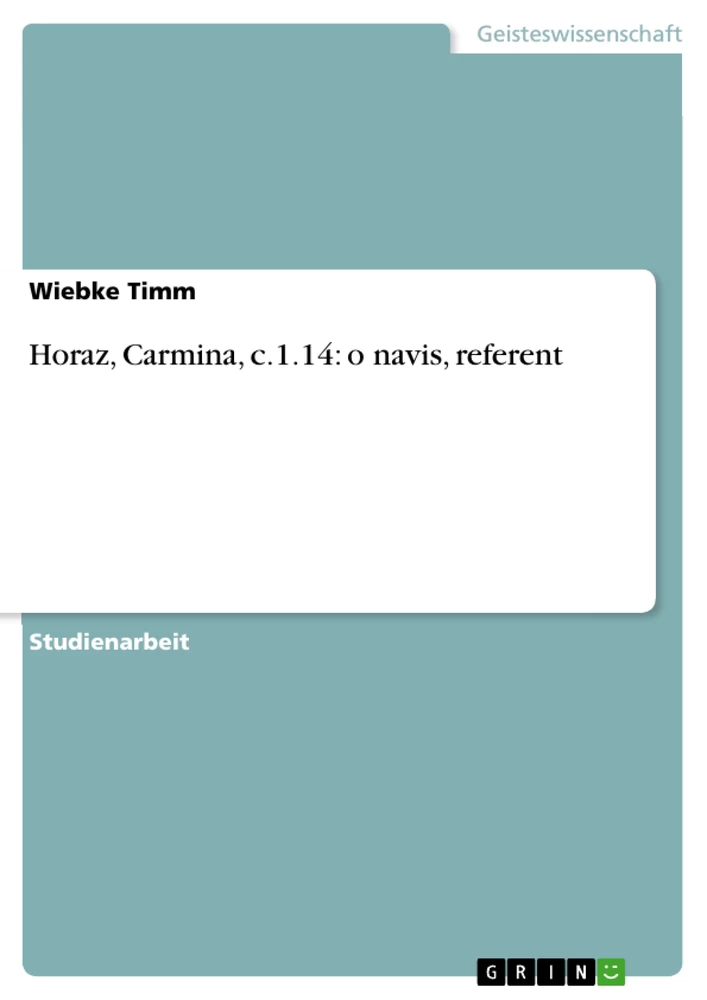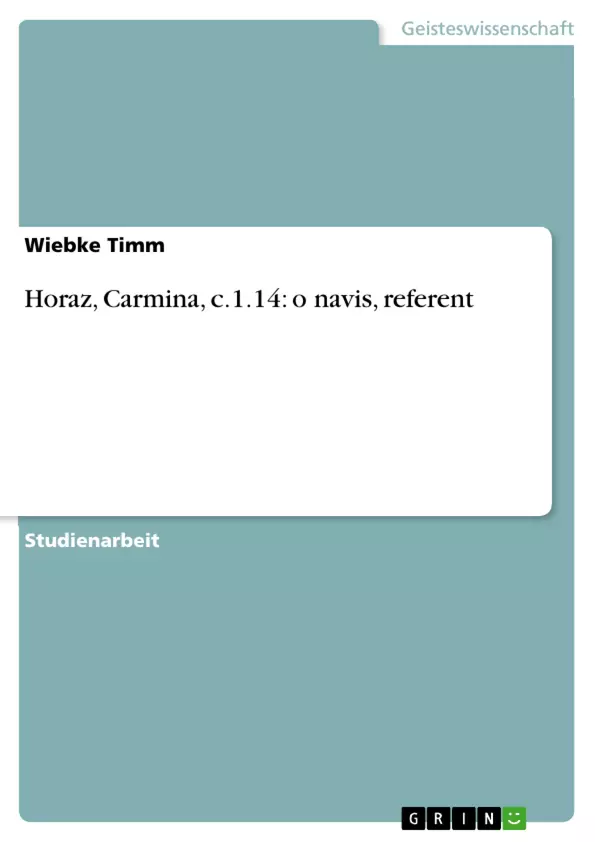Bei der Ode 1.14 des Horaz sind wir heute in der glücklichen Lage, einerseits die Deutung des Quintilian zu besitzen und andererseits zwei Alkaiosfragmente, nach denen Horaz seine Ode modelliert haben dürfte. Man kann also direkt zur Ode einen literarischen Hintergrund aufweisen, der in der vorliegenden Arbeit auch gebührend berücksichtigt werden soll.
Bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts war die Auslegung des Quintilian nahezu unangefochten, wenn es auch bereits unter Kommentatoren ab dem 16. Jahrhundert immer wieder Ansätze gab, die Ode auf eine Einzelperson wie beispielsweise Marcus Brutus und die Schlacht bei Philippi zu beziehen oder die navis rein literarisch zu verstehen und die Ode auf eine reale Bootsfahrt zu beziehen, wovon Bentley ausgeht, was Fraenkel jedoch auf den "Hyperkritizismus des 19. Jahrhunderts" zurückführt.
Doch besonders durch zwei Arbeiten, die Mendells von 1938, die er 1965 wiederaufnahm, und die Andersons von 1966, wurde die Notwendigkeit einer Staatsschiff-Allegorie in Frage gestellt und die Diskussion neu, wenn überhaupt erst belebt, wobei die neuen Ansätze bei den Philologen teils auf völliges Unverständnis bis hin zur Ignoranz prallten, teils begeistert aufgenommen und noch weiter ausgeführt wurden.
Aufgrund der Fülle der neueren Ansätze werden in dieser Arbeit nur die Mendells und Andersons exemplarisch vorgestellt, da beide Autoren es als erste wagten, die Interpretation der Ode in eine völlig neue Richtung zu lenken. Alle weiterführenden Gedanken anderer Philologen können somit leider nur am Rande berücksichtigt werden oder müssen ganz außer acht gelassen werden, weil sonst der Rahmen der Arbeit gesprengt würde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Paraphrase des Inhaltes
- Sachliche Erläuterungen
- Sprache und Stil des carmen
- Interpretation
- Warum ist die Ode als Allegorie zu verstehen?
- Auflösungsmöglichkeiten
- Staatsschiff
- Quintilian
- Alkaios und Ps.-Heraklit
- Vertrauter Topos
- Andere Varianten
- Das Schiff des Lebens
- Das Schiff der Liebe
- Staatsschiff
- Einordnung der Ode (zeitlich und in das Gesamtwerk)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Interpretation von Horaz' Ode 1.14, "o navis, referent". Sie untersucht die historische und literarische Einordnung der Ode, analysiert ihren Inhalt und beleuchtet verschiedene Interpretationsmöglichkeiten.
- Die Bedeutung der Staatsschiff-Allegorie
- Die Rolle von Quintilian und Alkaios in der Interpretation
- Die sprachlichen und stilistischen Besonderheiten der Ode
- Die Einordnung der Ode im Gesamtwerk von Horaz
- Alternative Interpretationsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die historische Einordnung der Ode und stellt die Bedeutung des Werkes von Quintilian und Alkaios für die Interpretation heraus. Das zweite Kapitel bietet eine Zusammenfassung des Inhalts der Ode. Das dritte Kapitel behandelt die sprachlichen und stilistischen Besonderheiten des Carmen. Das vierte Kapitel widmet sich verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten, darunter die Staatsschiff-Allegorie und andere Varianten.
Schlüsselwörter
Horaz, Ode 1.14, "o navis, referent", Staatsschiff, Allegorie, Quintilian, Alkaios, Interpretation, Sprache, Stil.
- Arbeit zitieren
- Wiebke Timm (Autor:in), 1996, Horaz, Carmina, c.1.14: o navis, referent, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1205