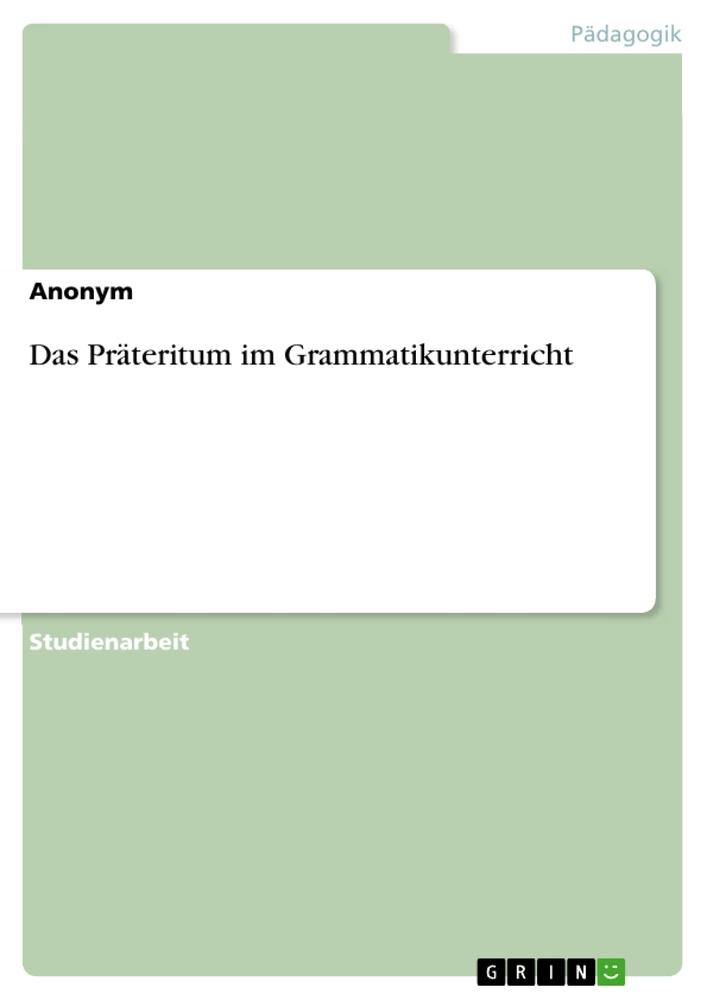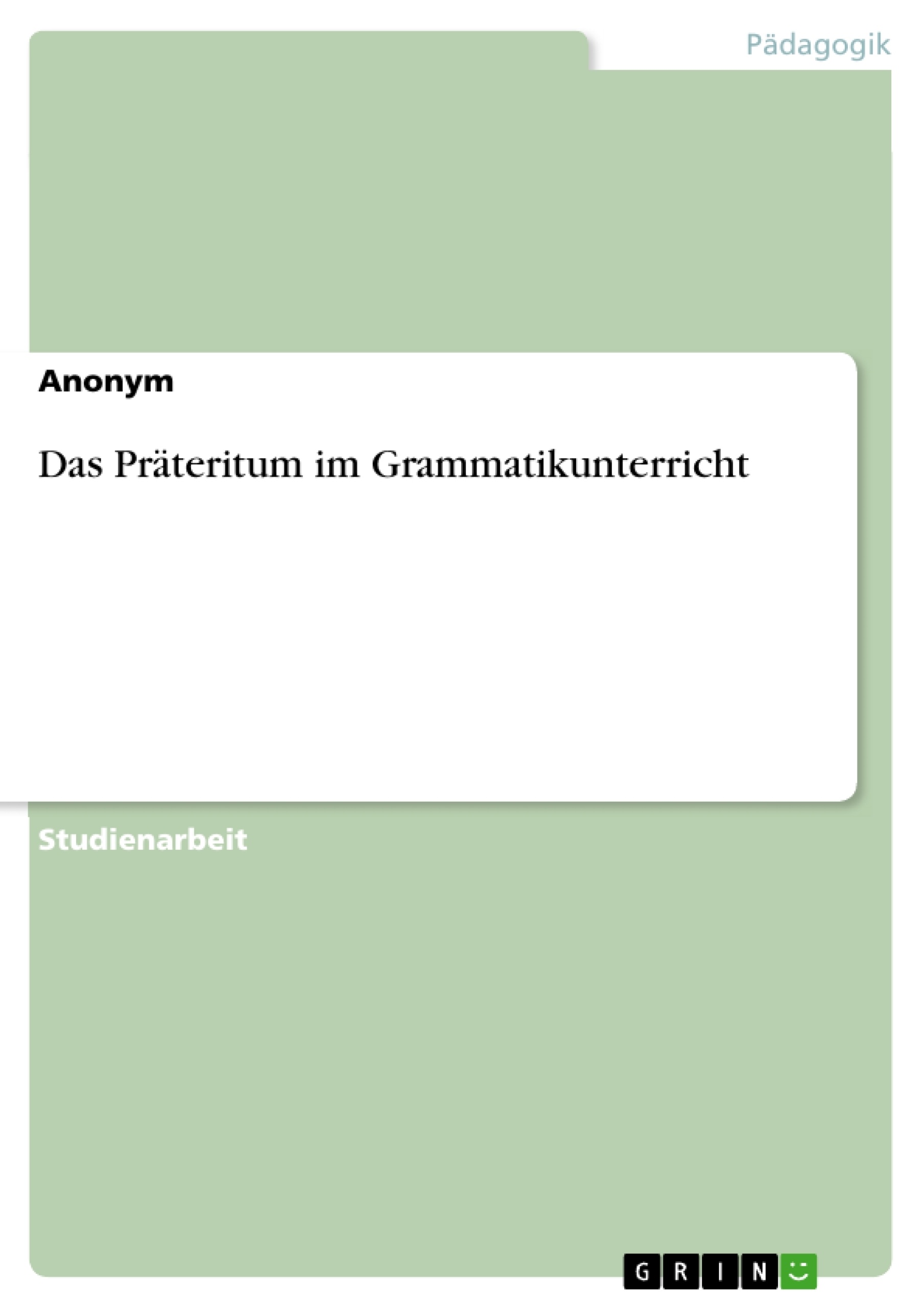Jedes Unterrichtsfach in der Schule hat eine beliebte und eine unbeliebte Seite, so auch der Deutschunterricht in der Grundschule. Zu der beliebten Seite zählen z.B. das Schreiben fiktiver Geschichten, das Vorlesen, die Rollenspiele oder die Leseecke. Unbeliebter Weise findet sich auf dieser Seite nicht der Grammatikunterricht. Dieser wird meist auf die Frage nach dem richtigen oder falschen Sprachwissen und auf die Kontrolle durch Tests reduziert. Die impliziten Sprachbetrachtungen, wie z.B. die Sprachspiele mit den Wörtern und den Ausdrücken werden meist gar nicht mit dem Grammatikunterricht verbunden. Ein Beispiel hierfür ist das Lied "Drei Chinesen mit dem Kontrabass", bei dem alle Vokale in den Strophen durch einen anderen Vokal ersetzt werden.
Darüber hinaus ist der Grammatikunterricht umfangreich, denn er beinhaltet und lehrt metasprachliche Handlungen, die sprachlichen Phänomene, Sprachbewusstheit und Handlungsfähigkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Der Grammatikunterricht
- Konzeptionen des Grammatikunterrichts
- Das Präteritum im Grammatikunterricht
- Kommentierung des Unterrichtsmaterials von Nowak und Schröder - Kräftemessen der Verben
- Selbst erstelltes Unterrichtsmaterial
- Reflexion des selbst erstellten Unterrichtsmaterials
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Grammatikunterricht in der Grundschule und untersucht die Relevanz des Präteritums im Unterricht. Sie analysiert verschiedene Konzeptionen des Grammatikunterrichts und beleuchtet die Bedeutung der Sprachreflexion, Sprachbewusstheit und des Wissens über die Struktur der deutschen Sprache.
- Der Grammatikunterricht in der Grundschule: Herausforderungen und Bedeutung
- Konzeptionen des Grammatikunterrichts: Historische Entwicklung und aktuelle Ansätze
- Das Präteritum als grammatisches Phänomen: Funktion, Verwendung und Schwierigkeiten
- Entwicklung und Einsatz von Unterrichtsmaterial zum Präteritum
- Reflexion über die Effektivität des Grammatikunterrichts im Hinblick auf die Sprachentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Der Grammatikunterricht
Dieses Kapitel untersucht die Rolle und Bedeutung des Grammatikunterrichts in der Grundschule. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf den Grammatikunterricht, von der Fokussierung auf korrekte Sprachverwendung bis hin zur Förderung von Sprachbewusstheit und Sprachreflexion. Der Text analysiert verschiedene Lernziele des Grammatikunterrichts, die von Eichler formuliert wurden, und stellt die Bedeutung des Grammatikunterrichts im Kontext der Curricularen Empfehlung der Kultusministerkonferenz dar.
Konzeptionen des Grammatikunterrichts
Dieses Kapitel geht auf verschiedene Konzeptionen des Grammatikunterrichts ein und beleuchtet die historische Entwicklung sowie aktuelle Ansätze. Es werden verschiedene Theorien und didaktische Modelle vorgestellt, die unterschiedliche Schwerpunkte und Methoden zur Vermittlung von Grammatikkenntnissen aufzeigen.
Das Präteritum im Grammatikunterricht
Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Präteritum und seine Rolle im Grammatikunterricht. Es beleuchtet die grammatische Struktur, die Funktionsweise und die Verwendung des Präteritums in der deutschen Sprache. Der Text analysiert die besonderen Herausforderungen, die das Präteritum für Schülerinnen und Schüler darstellt, und diskutiert mögliche Unterrichtsstrategien zur Bewältigung dieser Schwierigkeiten.
Kommentierung des Unterrichtsmaterials von Nowak und Schröder - Kräftemessen der Verben
Dieses Kapitel analysiert das Unterrichtsmaterial von Nowak und Schröder zum Thema "Kräftemessen der Verben" und bewertet dessen Eignung für den Grammatikunterricht. Es untersucht die didaktische Konzeption, die Aufgabenformate und die Lernziele des Materials und beurteilt dessen Potenzial für die Förderung von Sprachbewusstheit und Sprachkompetenz.
Selbst erstelltes Unterrichtsmaterial
Dieses Kapitel stellt das selbst erstellte Unterrichtsmaterial zum Thema Präteritum vor. Es beschreibt die Konzeption, die Lernziele und die Aufgabenformate des Materials. Der Text erklärt die didaktischen Prinzipien, die bei der Entwicklung des Materials berücksichtigt wurden, und erläutert die Auswahl der Aufgaben und Aktivitäten.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit zentralen Begriffen und Themenbereichen wie Grammatikunterricht, Sprachbewusstheit, Sprachreflexion, Präteritum, Konzeptionen des Grammatikunterrichts, Sprachentwicklung, Unterrichtsmaterial, didaktische Ansätze und Sprachkompetenz. Er beleuchtet die Bedeutung des Grammatikunterrichts in der Grundschule und untersucht die Rolle des Präteritums im Kontext der Sprachentwicklung und der Vermittlung von Sprachkenntnissen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Das Präteritum im Grammatikunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1193716