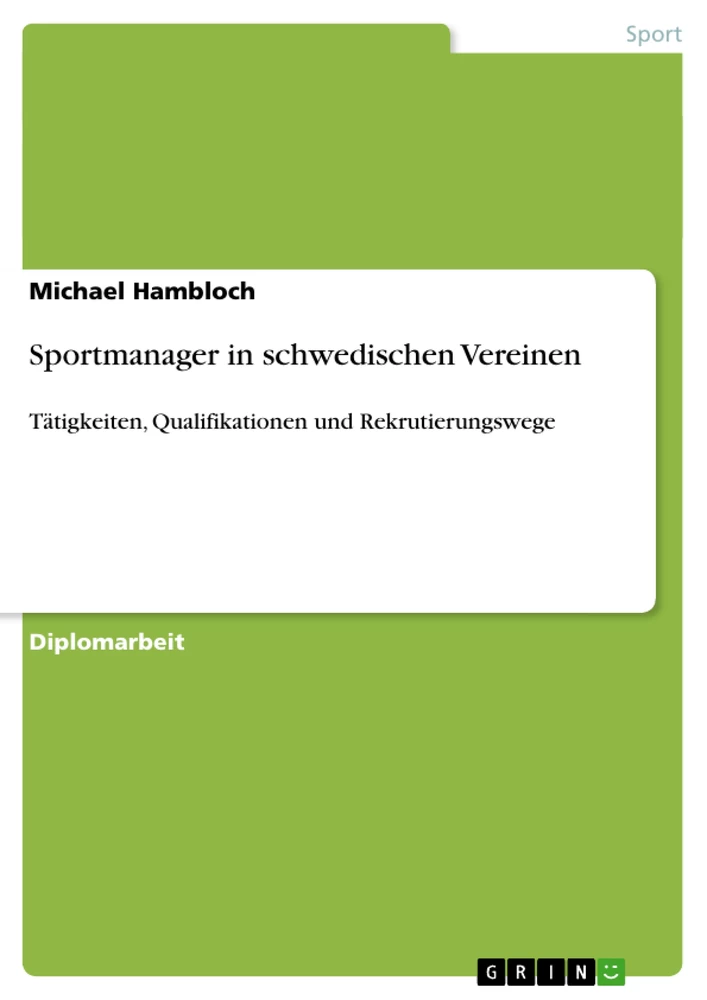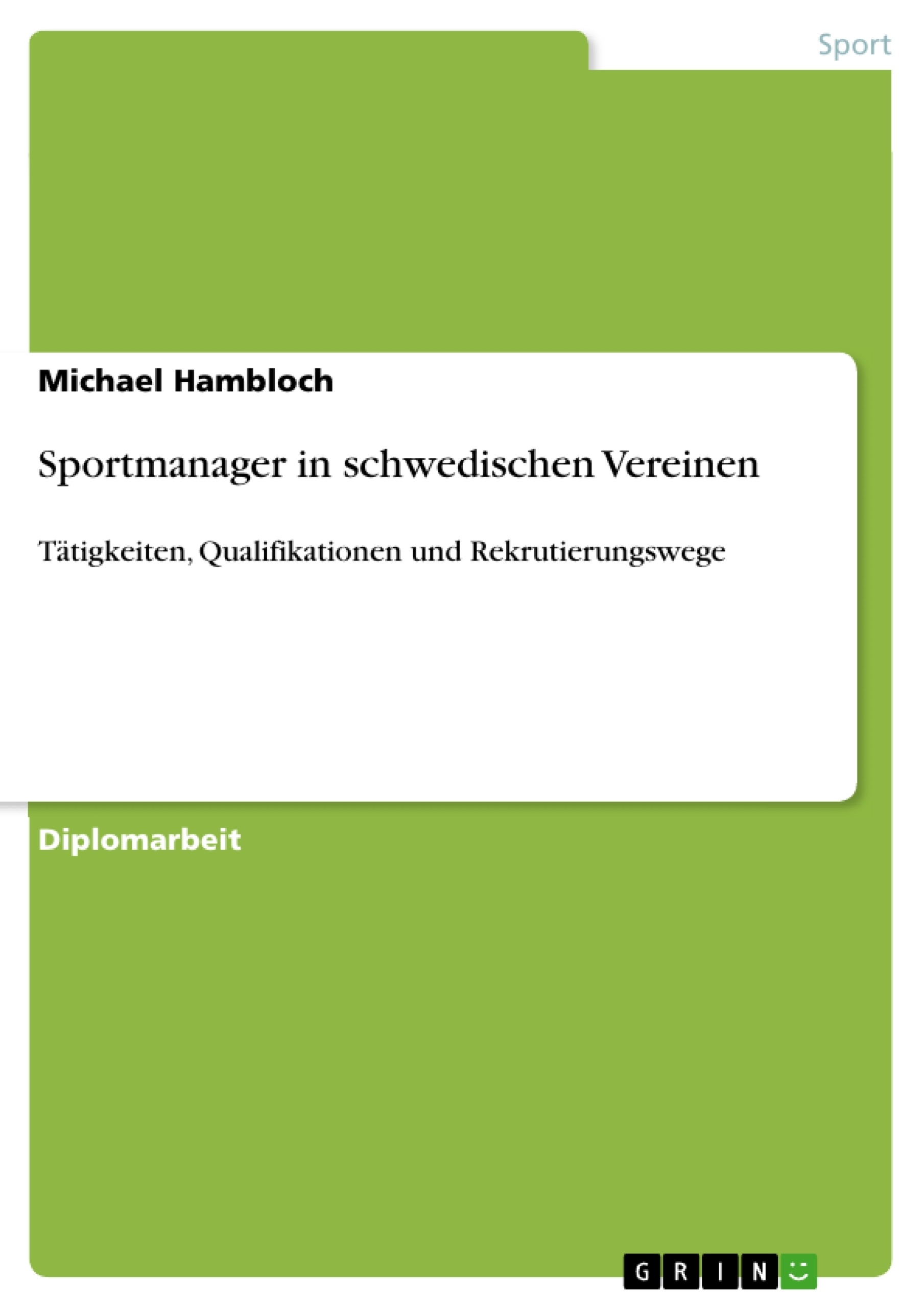Die Anforderungen an Sportmanager in Sportvereinen der heutigen Sportlandschaft werden immer komplexer und die wirtschaftliche Bedeutung immer größer (vgl. WEBER 1995; NICHELMANN 1999, 287; MEYER/AHLERT 2000). WEBER ermittelte im Jahr 1995, dass der Anteil des Sports am Bruttosozialprodukt bei 1,4 Prozent (15 Mrd. €) liegen und die sportbezogenen Ausgaben privater Haushalte 16 Mrd. € betragen würden. Damit liegt die wirtschaftliche Bedeutung des Sports nach WEBER in Bereichen der Landwirtschaft bzw. der Körperpflege- oder Tabakwarenindustrie. MEYER/AHLERT prognostizieren für das Jahr 2010 einen Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Produktion von Gütern und Dienstleistungen von 1,4 auf 2,5 Prozent. Dieser Trend wird mit der Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2006 und mit weiteren Investitionen in Ostdeutschland in Verbindung gebracht. Jedoch wird er sich vermutlich nicht mit dieser Dynamik über das Jahr 2010 hinaus weiterentwickeln. Des weiteren hängt diese Entwicklung mit der Kommerzialisierung und Professionalisierung des Sports zusammen. Kommerzialisierung meint, dass etwas zu einer Ware, die auf Märkten mit dem Ziel Profit zu erwirtschaften, angeboten wird (vgl. HEINEMANN, 1995). Kommerzialisierung ist somit Voraussetzung der Professionalisierung, d.h. der Arbeitsteilung. Fast täglich sind diesem Thema Artikel der Tagespresse zu entnehmen. Eine zunehmende Professionalisierung breitensportlicher Vereine wird unter den Wissenschaftlern jedoch kontrovers diskutiert. Während einige Wissenschaftler eine weitere Professionalisierung positiv bewerten, betrachten sie Andere als eine Gefahr für die Vereine die Gemeinnützigkeit, und somit Steuerprivilegien, zu verlieren (vgl. HEINEMANN 1990; SCHAIBLE 1990). Dementsprechend müsse man einen solchen Verlust vermeiden und sich wieder auf traditionelle Mitarbeitsformen konzentrieren und den kommerziellen Sportanbietern die Verberuflichung überlassen (vgl. WAGNER 1988, 171 f.). Was sind jedoch Indikatoren für solch einen Prozess der Professionalisierung im Sportmanagement, in dem eine eigene Profession bislang lediglich in Ansätzen existiert?
Inhaltsverzeichnis
- TEIL I: THEORETISCHER HINTERGRUND
- 1. Einleitung
- 2. Relevanz des Projektes
- 3. Zu den Bergriffen „Sportmanager“ und „Euro-Manager“
- 4. Forschungsstand
- 5. Methodischer Zugang
- 6. Das schwedische Sportmodell
- 7. Tätigkeitsforschung
- 8. Interkulturelle Notwendigkeit für Manager in Schweden
- 9. Vereinssituation in Deutschland
- 10. Angebote einer universitären Sportmanagementausbildung in Deutschland und in Schweden
- TEIL II: EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
- 1. Erstellung des Befragungsinstrumentes
- 2. Profildaten der befragten Personen und Organisationen
- 2.1 Positionsbezeichnungen
- 2.2 Beschäftigungsverhältnisse
- 2.3 Geschlecht und Alter
- 2.4 Anzahl der Vereinsmitglieder
- 2.5 Rolle des Hochleistungssports im Vergleich zum Breiten- und Freizeitsport
- 2.6 Anzahl der ehrenamtlichen bzw. hauptamtlichen Mitarbeiter
- 2.7 Bezahlte Führungskräfte
- 2.8 Beruf vor der bezahlten Vereinstätigkeit bzw. neben der ehrenamtlichen Tätigkeit
- 2.9 Bildungsabschluss
- 3. Tätigkeiten
- 3.1 Vergleich zum selbstverwaltendem Sport in Deutschland
- 3.2 Formalisierungsgrad
- 3.3 Vergleich zum selbstverwaltendem Sport in Deutschland
- 4. Qualifikationen
- 4.1 Vergleich zum selbstverwaltendem Sport in Deutschland
- 4.2 Weiterbildungsbedarf
- 4.3 Geforderte Qualifikationen für die Sportmanager der Zukunft
- 5. Rekrutierung
- 5.1 Vergleich zum selbstverwaltendem Sport in Deutschland
- 5.2 Sportbezug
- 5.3 Vergleich zum selbstverwaltendem Sport in Deutschland
- 6. Zum Professionalisierungsgrad des selbstverwaltenden Sport
- 6.1 Argumente, die für das Einstellen neuer Hauptamtlicher sprechen
- 6.2 Vergleich zum selbstverwaltenden Sport in Deutschland
- 6.3 Argumente, die gegen das Einstellen neuer Hauptamtlicher sprechen
- 6.4 Vergleich zum selbstverwaltenden Sport in Deutschland
- 7. Ziele, Organisationsformen und Rahmenbedingungen
- 7.1 Vergleich zum selbstverwaltenden Sport in Deutschland
- 8. Hauptamtliche und Führungsaufgaben
- Tätigkeitsfelder von Sportmanagern in Schweden
- Notwendige Qualifikationen für Sportmanager im schwedischen Kontext
- Rekrutierungsprozesse von Sportmanagern in schwedischen Vereinen
- Vergleich des schwedischen und deutschen Sportmodells
- Professionalisierungsgrad des Sports in Schweden im Vergleich zu Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Tätigkeiten, Qualifikationen und Rekrutierungswege von Sportmanagern in schwedischen Vereinen. Ziel ist es, einen Vergleich zwischen dem schwedischen und dem deutschen Sportmodell zu ziehen und Unterschiede aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I: Theoretischer Hintergrund legt den Fokus auf die Definition von Sportmanagern, den Forschungsstand, den methodischen Zugang und einen Vergleich des schwedischen und deutschen Sportmodells. Es werden die Begriffe "Sportmanager" und "Euro-Manager" geklärt und der methodische Ansatz der Arbeit erläutert. Kapitel 6 und 7 befassen sich mit dem schwedischen Sportmodell und der Tätigkeitsforschung. Kapitel 8 und 9 behandeln die interkulturellen Herausforderungen und die Situation der Vereine in Deutschland. Kapitel 10 widmet sich der Sportmanagementausbildung in beiden Ländern.
Teil II: Empirische Untersuchung beschreibt die Methodik der Befragung, präsentiert die Profildaten der befragten Personen und Organisationen, analysiert die Tätigkeiten, Qualifikationen und Rekrutierungswege der Sportmanager. Die Ergebnisse werden jeweils mit dem deutschen selbstverwaltenden Sport verglichen. Die Kapitel 3, 4 und 5 konzentrieren sich auf die Tätigkeiten, Qualifikationen und die Rekrutierung der Sportmanager. Kapitel 6 beleuchtet den Professionalisierungsgrad des Sports und die Argumente für und gegen die Einstellung neuer Hauptamtlicher. Kapitel 7 analysiert die Ziele, Organisationsformen und Rahmenbedingungen und Kapitel 8 die hauptamtlichen Führungsaufgaben.
Schlüsselwörter
Sportmanager, Schweden, Deutschland, Sportmodell, Qualifikation, Rekrutierung, Vergleich, Vereinsmanagement, Hauptamtlichkeit, Ehrenamtlichkeit, Professionalisierung, Empirische Untersuchung, Tätigkeitsforschung.
- Quote paper
- Diplom Sportwissenschaftler Michael Hambloch (Author), 2005, Sportmanager in schwedischen Vereinen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/119353