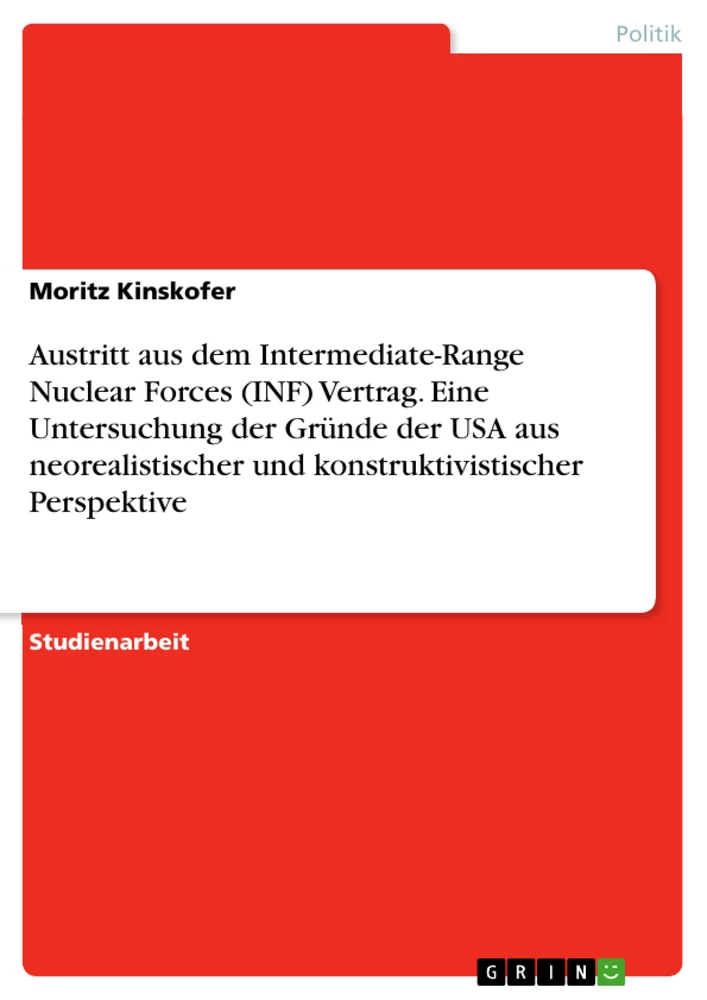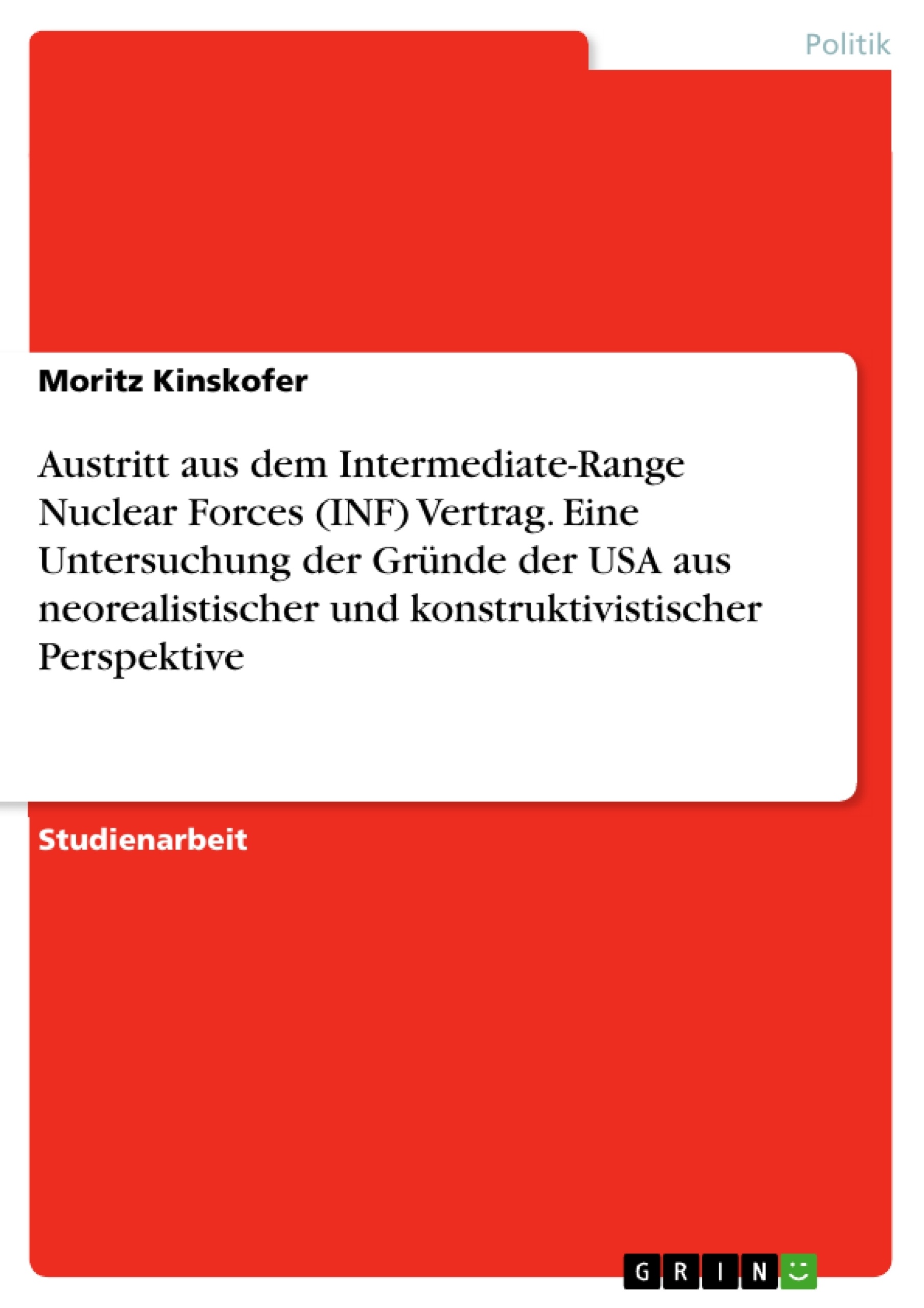Als Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ergibt sich die Frage, warum die USA aus dem INF-Vertrag ausgestiegen sind. Dieses Thema wird anhand zweier Theorien der internationalen Beziehungen zu beantworten versucht. Der Schwerpunkt der Arbeit wird dabei auf den Erklärungsansatz aus neorealistischer Perspektive gelegt, da diese mit Blick auf einen Vertrag, der eine quantitative Verringerung der militärischen Kapazitäten beziehungsweise das Verbot des Tests und Stationierung bestimmter Waffen der zwei größten Nuklearmächte regelt, am geeignetsten erscheint. Zuvor sollen jedoch kurz der Inhalt des INF-Vertrags dargelegt und der Hintergrund seiner Entstehung erläutert werden, um so ein besseres Verständnis für aktuelle Entscheidungen der USA und die denen vorausgehenden Russlands in diesem Kontext zu vermitteln. Als Grundlage der Untersuchung werden die neorealistische Theorie John Mearsheimers und die konstruktivistische Theorie Alexander Wendts herangezogen, aus denen zur Beantwortung der Forschungsfrage jeweils eine Hypothese abgeleitet wird, die es dann im Hauptteil durch Analyse des Sachverhalts zu überprüfen gilt.
Nach dem Austritt der USA aus dem Intermediate-range Nuclear Forces (INF) Vertrag könnten Trumps Drohgebärden künftig leichter durchzusetzen sein, da mit dem New Strategic Arms Reduction Treaty (New-START) nur noch eine einzige völkerrechtliche Limitation des amerikanischen nuklearen Waffenarsenals existiert, welche aber 2021 auslaufen wird, und nach dem Streit um die Verantwortung für das Ende des INF-Vertrags eine Verlängerung des New-START unwahrscheinlich erscheint. Fraglich ist also, ob die USA den INF-Vertrag tatsächlich mit der Intention aufgekündigt haben, in Zukunft mehr oder weniger uneingeschränkt ihre militärischen Kapazitäten aufrüsten und davon Gebrauch machen zu können, oder ob der Austritt lediglich eine Warnung an Russland darstellen und als Aufruf zur Schließung eines effektiveren Vertrags dienen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Thema
- Literaturbericht
- Überblick über den INF-Vertrag
- Theorien
- Neorealismus
- Konstruktivismus
- Der Austritt aus dem INF-Vertrag aus neorealistischer und konstruktivistischer Sicht
- Notwendige Abschreckung gegenüber Russland und China?
- Erwiderung russischer Aufrüstung befreit von vertraglicher Einschränkung
- Austritt als längst überfälliger Schritt zur Anwort auf wachsenden Einfluss Chinas
- Schlechte Erfahrungen mit Russland?
- Austritt als Reaktion auf Russlands anhaltenden Vertragsbruch
- Austritt als ultima ratio der vertragstreuen USA
- Notwendige Abschreckung gegenüber Russland und China?
- Fazit und Gründe für den Austritt der USA aus dem INF-Vertrag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Gründe für den Austritt der USA aus dem INF-Vertrag. Sie analysiert dieses Thema aus der Perspektive des Neorealismus und des Konstruktivismus. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erklärungsansatz des Neorealismus, da dieser besonders geeignet erscheint, um die Entscheidung der USA im Kontext eines Vertrages zu analysieren, der quantitative Reduzierung militärischer Kapazitäten und Verbote für bestimmte Waffentypen der beiden größten Nuklearmächte beinhaltet.
- Gründe für den Austritt der USA aus dem INF-Vertrag
- Analyse der Entscheidung der USA aus neorealistischer und konstruktivistischer Perspektive
- Bewertung der Rolle von Russland und China
- Bedeutung des INF-Vertrags für die internationale Sicherheitsarchitektur
- Analyse der amerikanischen Sicherheitsinteressen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert einen einleitenden Überblick über das Thema und die Forschungsfrage. Es stellt die Relevanz des INF-Vertrags im Kontext der internationalen Sicherheitspolitik dar und beleuchtet die aktuelle Debatte um den Austritt der USA. Das zweite Kapitel bietet eine kurze Zusammenfassung der relevanten Literatur. Das dritte Kapitel widmet sich dem INF-Vertrag selbst und erläutert dessen Entstehung, Inhalt und Bedeutung. Das vierte Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, den Neorealismus und den Konstruktivismus. Das fünfte Kapitel analysiert den Austritt der USA aus dem INF-Vertrag aus beiden theoretischen Perspektiven und erörtert die Argumente, die für eine neorealistische und eine konstruktivistische Sichtweise sprechen. Das sechste Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
INF-Vertrag, Neorealismus, Konstruktivismus, Internationale Politik, Nuklearwaffen, Rüstungskontrolle, USA, Russland, China, Sicherheit, Abschreckung, Machtpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Inhalt des INF-Vertrags?
Der INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) von 1987 verbot den USA und der Sowjetunion (später Russland) den Besitz, Test und die Produktion von landgestützten Raketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern.
Warum sind die USA aus dem INF-Vertrag ausgestiegen?
Offizielle Gründe waren jahrelange Vertragsverletzungen durch Russland (Entwicklung neuer Raketensysteme) sowie die Tatsache, dass China, das nicht an den Vertrag gebunden war, massiv aufrüstete.
Wie erklärt der Neorealismus den Austritt der USA?
Aus neorealistischer Sicht (z.B. John Mearsheimer) handeln Staaten im Sinne ihrer Sicherheit und Machtposition. Der Austritt wird als notwendige Reaktion auf die Bedrohung durch Russland und China gesehen, um das militärische Gleichgewicht zu wahren.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus bei dieser Analyse?
Der Konstruktivismus (z.B. Alexander Wendt) fokussiert auf Identitäten und Normen. Hier wird untersucht, wie schlechte Erfahrungen mit Russland das Vertrauen zerstört haben und wie die USA ihre Rolle in der Weltordnung definieren.
Was bedeutet das Ende des INF-Vertrags für die globale Sicherheit?
Es wird befürchtet, dass ein neues Wettrüsten beginnt, da nun eine zentrale völkerrechtliche Beschränkung für Mittelstreckenraketen weggefallen ist, was die Stabilität insbesondere in Europa und Asien gefährden könnte.
- Arbeit zitieren
- Moritz Kinskofer (Autor:in), 2019, Austritt aus dem Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Vertrag. Eine Untersuchung der Gründe der USA aus neorealistischer und konstruktivistischer Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1192700