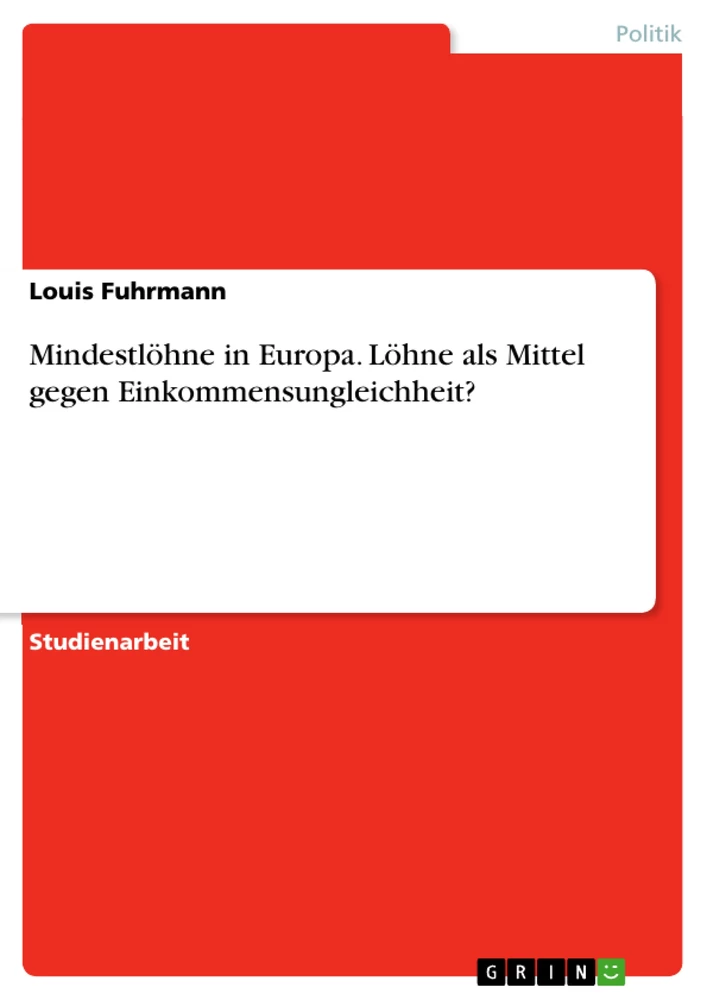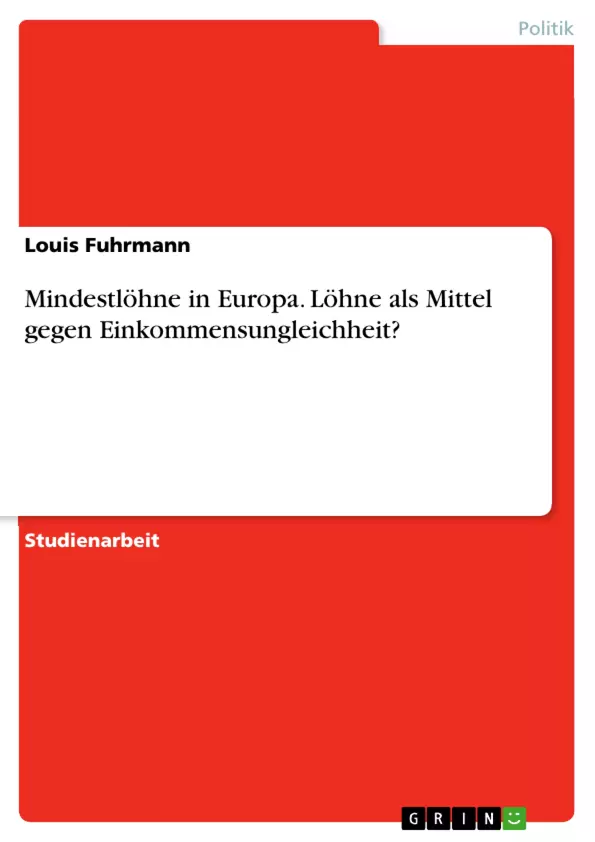Der Mindestlohn in Deutschland war bereits vor seiner Einführung im Jahr 2015 ein heiß diskutiertes Thema. Auch im Superwahljahr 2021 kehrt die Forderung nach einem Mindestlohn von 12 Euro zurück an die Spitze der politischen Agenda. Doch welchen Einfluss hat die Einführung eines Mindestlohns auf die betroffenen, die an und um diese Lohnuntergrenze ihr Haushaltseinkommen erwirtschaften? Diese Arbeit soll auf der Grundlage des Goldthorpe-Klassenschemas die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Höhe des Mindestlohns und der damit verbundenen Empfindung nach Einkommensgerechtigkeit beantworten. Leiten soll dabei die These, dass ein hoher Mindestlohn auch die gefühlte Einkommensgerechtigkeit positiv beeinflusst und diese dadurch als weniger stark ausgeprägt wahrgenommen wird.
Zur Beantwortung dieser Fragestellung soll zunächst das Goldthorpe-Klassenschema vorgestellt werden um darauf aufbauend die Auswirkungen von Mindestlöhnen auf den Arbeitnehmer sowie auf ganze Volkswirtschaften darzulegen. Danach werden die unterschiedlichen Mindestlohnsysteme in Europa vorgestellt um dann, vorbereitend auf die Analyse, Indikatoren einzuführen, die Mindestlöhne miteinander vergleichbar machen.
Die Analyse besteht aus dem Abgleich der Höhe des sogenannten Kaitz-Index verschiedener Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit den Ergebnissen einer Eurobarometer Umfrage zur sozialen Ungleichheit aus dem Jahr 2018.
Nach der Untersuchung und Interpretation der Empirie soll ein Fazit gezogen werden, um den Forschungsprozess zu resümieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Goldthorpe-Klassenschema
- Auswirkungen von Mindestlöhnen
- Ripple-Effekte
- Arbeitsplatzzufriedenheit & -qualität
- Mindestlohn und Armutsgefährdung
- Die Einführung des Mindestlohns in Deutschland
- Mindestlöhne in Europa
- Indikatoren zum Vergleich von Mindestlöhnen
- Nominale Höhe
- Kaufkraftstandard
- Kaitz-Index
- Steuern und Abgaben
- Analyse
- Interpretation der Ergebnisse
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Höhe des Mindestlohns und der gefühlten Einkommensgerechtigkeit, basierend auf dem Goldthorpe-Klassenschema. Die zentrale These ist, dass ein hoher Mindestlohn die wahrgenommene Einkommensgerechtigkeit positiv beeinflusst. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von Mindestlöhnen auf Arbeitnehmer und Volkswirtschaften, vergleicht Mindestlohnsysteme in Europa und untersucht empirische Daten, um die These zu überprüfen.
- Das Goldthorpe-Klassenschema und seine Anwendung auf die Analyse von Mindestlöhneffekten.
- Auswirkungen von Mindestlöhnen auf die Einkommensgerechtigkeit.
- Vergleich verschiedener Mindestlohnsysteme in Europa.
- Empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen Mindestlohn und gefühlter Einkommensgerechtigkeit.
- Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Forschungsfrage.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Mindestlohns ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Mindestlohn und gefühlter Einkommensgerechtigkeit dar. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der auf dem Goldthorpe-Klassenschema basiert, und umreißt den Aufbau der Arbeit. Das Zitat von Horst Köhler verdeutlicht die kontroverse Debatte um den Mindestlohn und seine potenziellen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Arbeit soll die These untersuchen, dass ein hoher Mindestlohn die gefühlte Einkommensgerechtigkeit positiv beeinflusst.
Das Goldthorpe-Klassenschema: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Goldthorpe-Klassenschema (auch EGP-Schema genannt), das auf den Überlegungen von John Harry Goldthorpe basiert und die Klassenlage von Personen anhand ihrer beruflichen Stellung bestimmt. Es verknüpft die theoretischen Ansätze von Marx und Weber und differenziert zwischen Arbeitgebern, Selbstständigen und Arbeitnehmern, wobei letztere in sieben Unterkategorien unterteilt werden, basierend auf der Art der Regulierung ihres Arbeitsverhältnisses. Die Unterscheidung zwischen klassischem Arbeitsverhältnis und Dienstverhältnis wird hervorgehoben, wobei die Autonomie des Arbeitnehmers als entscheidendes Kriterium für die Klassenzuordnung dient. Der Fokus liegt auf der unterschiedlichen Kontrolle und den unterschiedlichen Arten der Überwachung der Arbeitstätigkeiten in den verschiedenen Klassen.
Auswirkungen von Mindestlöhnen: Dieses Kapitel beleuchtet die vielschichtigen Auswirkungen von Mindestlöhnen, unterteilt in Ripple-Effekte, Auswirkungen auf Arbeitsplatzzufriedenheit und -qualität, sowie auf die Armutsgefährdung. Es wird ein umfassendes Bild der direkten und indirekten Folgen eines Mindestlohns auf die betroffenen Personen und die gesamte Volkswirtschaft gezeichnet. Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Aspekten werden detailliert dargestellt, um ein ganzheitliches Verständnis der Thematik zu ermöglichen. Die Diskussion integriert dabei die theoretischen Grundlagen des Goldthorpe-Schemas, um die Auswirkungen auf die verschiedenen Klassen zu analysieren.
Die Einführung des Mindestlohns in Deutschland: Dieses Kapitel behandelt die Einführung des Mindestlohns in Deutschland im Jahr 2015 und seine politischen und sozioökonomischen Folgen. Es untersucht die Debatten und Kontroversen, die der Einführung vorausgingen, und analysiert die empirischen Daten zur Wirkung des Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt und die Einkommensverteilung. Die Analyse wird im Kontext der deutschen Wirtschaft und der spezifischen sozialen und politischen Rahmenbedingungen durchgeführt. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des deutschen Modells im Vergleich mit internationalen Standards.
Mindestlöhne in Europa: Dieser Abschnitt widmet sich einem Vergleich verschiedener Mindestlohnsysteme in Europa. Er stellt unterschiedliche nationale Ansätze dar und untersucht verschiedene Indikatoren zur Vergleichbarkeit von Mindestlöhnen, wie nominale Höhe, Kaufkraftstandard und Kaitz-Index. Die Analyse berücksichtigt nationale Besonderheiten und zeigt die Herausforderungen bei internationalen Vergleichen auf. Der Fokus liegt auf der Erstellung eines methodisch fundierten Vergleichsrahmens.
Schlüsselwörter
Mindestlohn, Einkommensgerechtigkeit, Goldthorpe-Klassenschema, soziale Ungleichheit, Europa, Arbeitnehmer, Arbeitsmarkt, Ripple-Effekte, Kaufkraft, Kaitz-Index, Eurobarometer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen von Mindestlöhnen auf die Einkommensgerechtigkeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Höhe des Mindestlohns und der gefühlten Einkommensgerechtigkeit, basierend auf dem Goldthorpe-Klassenschema. Die zentrale These lautet, dass ein hoher Mindestlohn die wahrgenommene Einkommensgerechtigkeit positiv beeinflusst.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von Mindestlöhnen auf Arbeitnehmer und Volkswirtschaften, vergleicht Mindestlohnsysteme in Europa und untersucht empirische Daten, um die These zu überprüfen. Das Goldthorpe-Klassenschema dient als zentrale Methode zur Analyse der Klassenlage und der Auswirkungen des Mindestlohns auf verschiedene soziale Gruppen.
Was ist das Goldthorpe-Klassenschema und wie wird es angewendet?
Das Goldthorpe-Klassenschema (EGP-Schema) differenziert die Klassenlage von Personen anhand ihrer beruflichen Stellung. Es kombiniert die Ansätze von Marx und Weber und unterteilt die Bevölkerung in Arbeitgeber, Selbstständige und Arbeitnehmer (unterteilt in sieben Unterkategorien basierend auf der Art der Arbeitsverhältnisregulierung und Autonomie). Die Arbeit nutzt dieses Schema, um die Auswirkungen des Mindestlohns auf verschiedene Klassen zu analysieren.
Welche Auswirkungen von Mindestlöhnen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Ripple-Effekte von Mindestlöhnen, deren Auswirkungen auf die Arbeitsplatzzufriedenheit und -qualität sowie auf die Armutsgefährdung. Es wird ein umfassendes Bild der direkten und indirekten Folgen eines Mindestlohns auf Einzelpersonen und die Volkswirtschaft gezeichnet.
Wie wird der Mindestlohn in Deutschland behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einführung des Mindestlohns in Deutschland im Jahr 2015, die vorausgegangenen Debatten und Kontroversen sowie die empirischen Daten zur Wirkung auf den Arbeitsmarkt und die Einkommensverteilung. Der Fokus liegt auf dem deutschen Modell im Vergleich zu internationalen Standards.
Wie werden Mindestlöhne in Europa verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Mindestlohnsysteme in Europa, stellt nationale Ansätze dar und untersucht Indikatoren wie nominale Höhe, Kaufkraftstandard und Kaitz-Index. Nationale Besonderheiten und Herausforderungen bei internationalen Vergleichen werden berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Mindestlohn, Einkommensgerechtigkeit, Goldthorpe-Klassenschema, soziale Ungleichheit, Europa, Arbeitnehmer, Arbeitsmarkt, Ripple-Effekte, Kaufkraft, Kaitz-Index, Eurobarometer.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Goldthorpe-Klassenschema, Auswirkungen von Mindestlöhnen, Einführung des Mindestlohns in Deutschland, Mindestlöhne in Europa, Analyse, Interpretation der Ergebnisse und Schlussbemerkungen.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die zentrale These ist, dass ein hoher Mindestlohn die wahrgenommene Einkommensgerechtigkeit positiv beeinflusst.
- Arbeit zitieren
- Louis Fuhrmann (Autor:in), 2021, Mindestlöhne in Europa. Löhne als Mittel gegen Einkommensungleichheit?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1192278