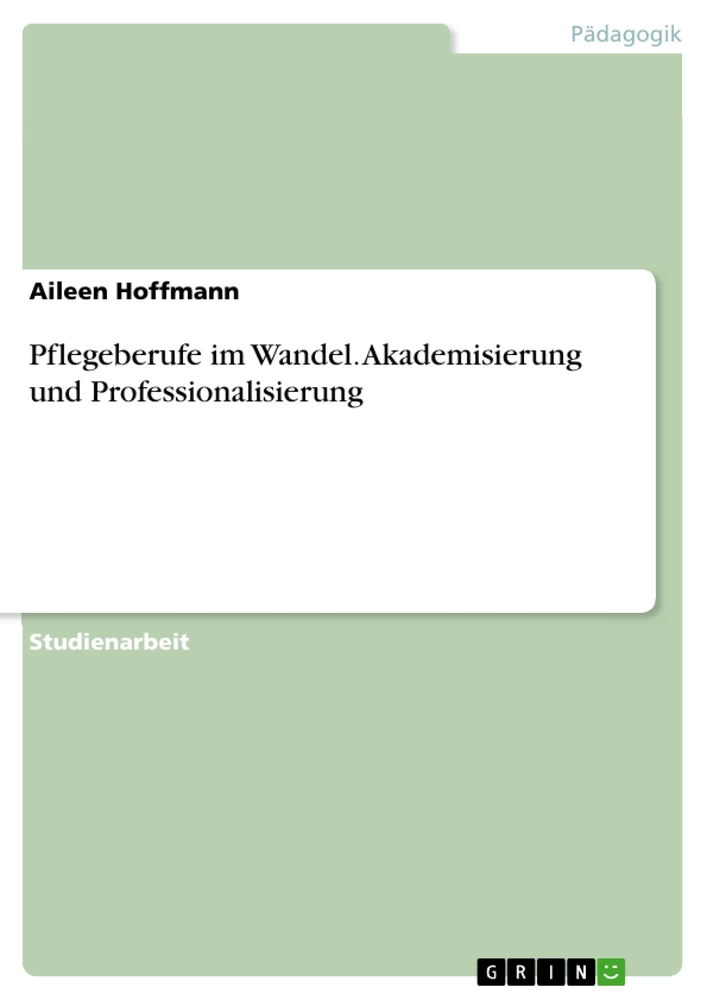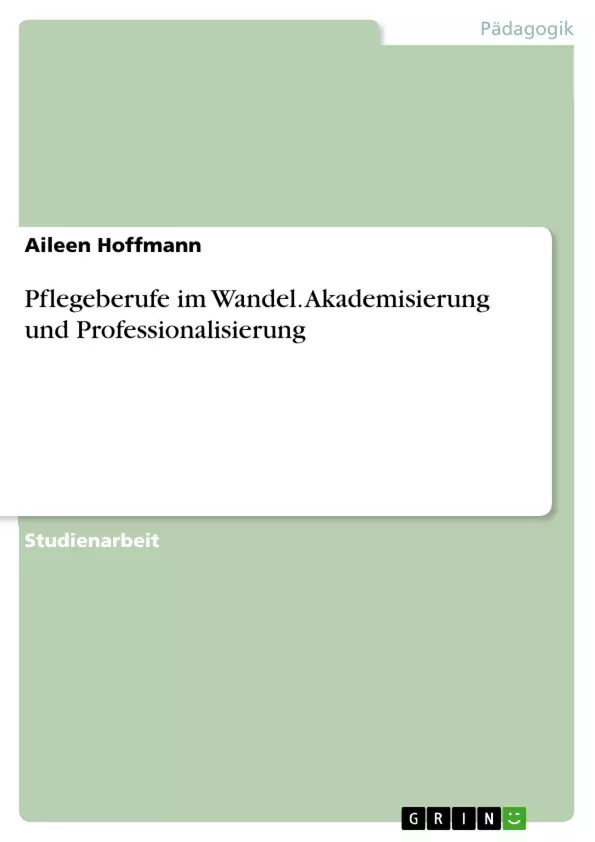Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Pflegeberufen im Wandel. Insbesondere versucht sie die Frage zu beantworten, ob man von einer Entwicklung zur Profession sprechen kann.
Die anhaltende Krise der Pflegeberufe kann auf fehlende Fort-, Weiter- und Ausbildungsbereiche zurückgeführt werden. Der Beruf wird traditionell mit frauenspezifischen Tätigkeiten und hohen Belastungen verbunden, sodass eine Reform notwendig wäre. Andere Faktoren wie die Zunahme von chronischen Krankheiten, steigende Versorgungsansprüche, Rückgang von familiären beziehungsweise Laien-Pflegekräften führen zu einem erhöhten Bedarf an Pflegekräften.
Die Ausweitung von pflegerischen Aufgaben, wie die Prävention oder die Beratung, sowie technische und pflegewissenschaftliche Innovationen führen zu neuen Anforderungen im Berufsfeld. In den letzten Jahren haben Pflegeberufe an gesellschaftlicher Relevanz gewonnen, dennoch gibt es Diskussionen für eine anerkannte Profession. An den Merkmalen der klassischen Profession gemessen wird den Pflegeberufen meist der Status eines voll professionalisierten Berufes aberkannt. Die Reformbestrebungen werden seit Beginn der 90er Jahre mit der einhergehenden Akademisierung und dem Begriff der „Professionalisierung“ konfrontiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pflegeausbildung im Wandel
- Entwicklung zur Profession
- Akademisierung der Pflegeberufe
- Theoretische Ansätze
- Professionalisierung
- Profession
- Professionalität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob sich die Pflegeberufe im Wandel zur Profession entwickeln. Sie analysiert die veränderte Pflegeausbildung, insbesondere die Entwicklung zur Profession und die Akademisierung. Darüber hinaus werden theoretische Ansätze der Professionalisierung, Profession und Professionalität beleuchtet. Das Fazit fasst die Argumente zusammen und gibt eine Antwort auf die Forschungsfrage.
- Entwicklung der Pflegeausbildung
- Professionalisierung der Pflege
- Akademisierung der Pflegeberufe
- Theoretische Ansätze zur Profession
- Debatte um die Anerkennung der Pflege als Profession
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung schildert die aktuelle Situation in den Pflegeberufen, die durch Personalmangel und hohe Belastungen geprägt ist. Sie verdeutlicht die Relevanz des Themas und die Notwendigkeit einer Reform. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Entwicklung der Pflegeberufe zur Profession und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
2. Pflegeausbildung im Wandel
Dieses Kapitel beleuchtet die veränderte Pflegeausbildung im Kontext der Entwicklung zur Profession. Es analysiert die Akteure und die Veränderungen der Arbeitsaufgaben, sowie den Stand der Professionalisierung. Im zweiten Teilbereich wird die Akademisierung der Pflege betrachtet und die Reformen der Studiengänge beleuchtet.
2.1 Entwicklung zur Profession
Dieser Abschnitt beleuchtet die Debatte um die Zuordnung der Pflege zur Profession. Es werden die verschiedenen Perspektiven auf die Professionalisierung und die Bedeutung des Begriffs für die Pflege analysiert. Die Bedeutung von Autonomie und die Herausforderungen im Wettbewerb mit anderen Berufsgruppen werden diskutiert.
2.2 Akademisierung der Pflegeberufe
Dieses Kapitel beleuchtet den Prozess der Akademisierung der Pflegeberufe und den Mehrwert des Hochschulstudiums. Es wird die Entwicklung der ersten Pflegestudiengänge, die Kritik und das Engagement der Wissenschaftler in diesem Prozess betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Pflegeausbildung, Professionalisierung, Akademisierung, Profession und Professionalität. Die zentralen Themen sind die Entwicklung der Pflegeberufe im Wandel, die Debatte um die Anerkennung als Profession, die Rolle von Autonomie und die Herausforderungen der Akademisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Akademisierung in der Pflege?
Akademisierung beschreibt die Einführung von Hochschulstudiengängen für Pflegeberufe, um wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Praxis zu integrieren und das Berufsbild aufzuwerten.
Gilt die Pflege heute als anerkannte Profession?
In der Soziologie wird der Pflege oft noch der Status einer „vollprofessionalisierten“ Profession abgesprochen, da sie oft in Abhängigkeit zu Ärzten steht, was sich jedoch durch Reformen ändert.
Warum ist eine Reform der Pflegeausbildung notwendig?
Steigende Anforderungen durch chronische Krankheiten, technologische Innovationen und der Fachkräftemangel erfordern eine modernere und attraktivere Ausbildung.
Was unterscheidet „Professionalisierung“ von „Professionalität“?
Professionalisierung ist der Prozess der Aufwertung eines Berufs zur Profession, während Professionalität das kompetente Handeln des Einzelnen in seinem Berufsfeld beschreibt.
Welche Rolle spielen frauenspezifische Rollenbilder in der Pflege?
Historisch wurde Pflege oft als „natürliche“ Frauentätigkeit ohne akademischen Anspruch gesehen, was die Anerkennung als eigenständige Wissenschaft lange Zeit erschwert hat.
- Arbeit zitieren
- Aileen Hoffmann (Autor:in), 2018, Pflegeberufe im Wandel. Akademisierung und Professionalisierung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1191478