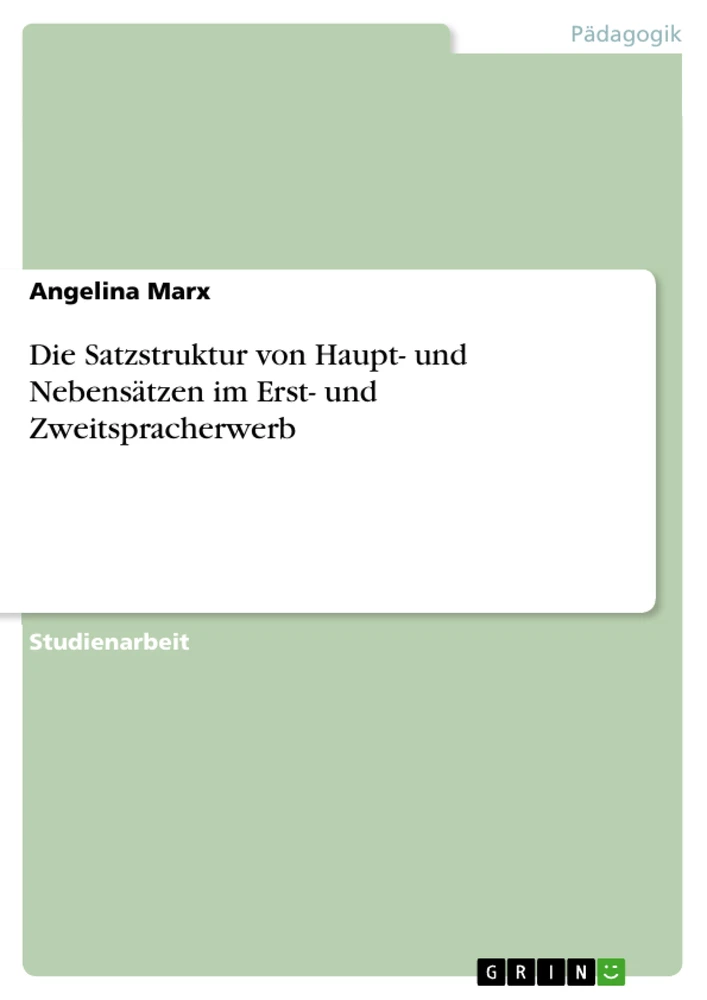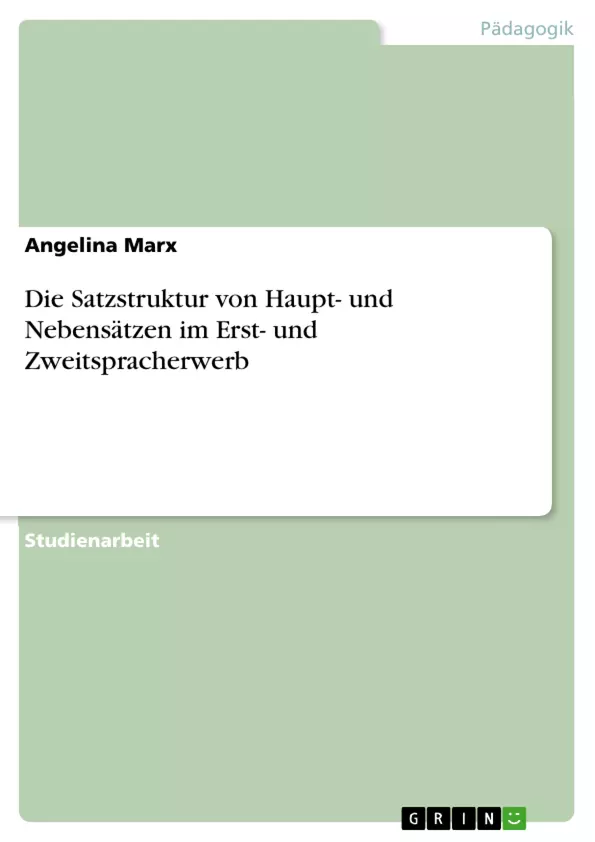Dieser Beitrag befasst sich mit den Parallelen und Unterschieden des monolingualen Erstspracherwerbs des Deutschen und den verschiedenen ungesteuerten Erwerbstypen des Zweitspracherwerbs. Ich werde auf die deutsche Grammatik mit Fokus auf die Haupt- und Nebensätze eingehen, bevor ich den Erwerbsverlauf für kindliche Erstsprachlernende skizziere. Darauffolgend widme ich mich der Erklärung und Einstufung der Erwerbstypen im groben. Fortlaufend werde ich den Spracherwerb der frühen, späten und erwachsenen Zweitsprachlernenden im Detail mit dem Erwerbsverlauf der monolingualen Kinder, mit Fokus auf die Satzstellung von Haupt- und Nebensätzen vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprachwissenschaftliche Grundlagen der Haupt- und Nebensätze
- 2.1 Erwerbsverlauf für monolinguale deutsche Kinder
- 2.2 Erwerbstypen
- 2.3 Der frühe Zweitspracherwerb
- 2.4 Der späte Zweitspracherwerb
- 2.5 Der Zweitspracherwerb Erwachsener
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Erwerb von Haupt- und Nebensätzen im Erst- und Zweitspracherwerb Deutsch. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des monolingualen Erstspracherwerbs mit verschiedenen Zweitspracherwerbs-Typen. Die Arbeit skizziert zunächst die sprachwissenschaftlichen Grundlagen und den Erwerbsverlauf im Erstspracherwerb, bevor sie verschiedene Zweitspracherwerbs-Typen erläutert und vergleicht.
- Vergleich des Erst- und Zweitspracherwerbs deutscher Satzstrukturen
- Analyse der Entwicklung von Haupt- und Nebensätzen
- Untersuchung verschiedener Zweitspracherwerbs-Typen (früh, spät, Erwachsene)
- Beschreibung der sprachwissenschaftlichen Grundlagen von Haupt- und Nebensätzen
- Entwicklungsstufen im kindlichen Erstspracherwerb
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein, welches den Vergleich des monolingualen Erstspracherwerbs des Deutschen mit verschiedenen Zweitspracherwerbstypen zum Ziel hat. Es wird angekündigt, dass die Arbeit auf die deutsche Grammatik mit Fokus auf Haupt- und Nebensätze eingehen wird, den Erwerbsverlauf für kindliche Erstsprachlernende skizzieren und anschließend die Erwerbstypen im Zweitspracherwerb erklären und einordnen wird. Schließlich wird der Vergleich des Spracherwerbs verschiedener Zweitsprachlernender (früh, spät und erwachsen) mit dem Erwerbsverlauf monolingualer Kinder detailliert behandelt, wobei der Fokus auf der Satzstellung von Haupt- und Nebensätzen liegt.
2. Sprachwissenschaftliche Grundlagen der Haupt- und Nebensätze: Dieses Kapitel legt die sprachwissenschaftlichen Grundlagen für das Verständnis von Haupt- und Nebensätzen im Deutschen dar. Es wird der Unterschied zwischen Haupt- und Nebensätzen erläutert, wobei auf die unterschiedliche Verbposition (Verbzweitstellung im Hauptsatz, Verbendstellung im Nebensatz) eingegangen wird. Das topologische Feldermodell wird als Werkzeug zur Visualisierung der Satzstruktur vorgestellt und anhand von Beispielen veranschaulicht. Die Kapitel diskutiert die Besetzung der Satzklammer in Haupt- und Nebensätzen und die Unterschiede im Vorfeld beider Satztypen. Die asymmetrische Belegung der Satzklammer wird als grundlegender Unterschied zwischen Haupt- und Nebensatz hervorgehoben.
2.1 Erwerbsverlauf für monolinguale deutsche Kinder: Dieses Kapitel beschreibt den Erwerbsverlauf von Satzstrukturen bei monolingualen deutschen Kindern. Es werden die Entwicklungsstufen des Spracherwerbs nach Thoma/Tracy (vier Meilensteine) erläutert. Die einzelnen Meilensteine werden detailliert beschrieben, von den Einwortäußerungen über Zweiwortäußerungen bis hin zum Erwerb der Verbzweit-Stellung. Es wird auf die Herausforderungen und Besonderheiten des kindlichen Spracherwerbs eingegangen, wie z.B. die frühe Erkennung der rechten Satzklammer durch die Kombination unflektierter Verben und Verbpartikel. Die Entwicklung des Satzverständnisses und der zunehmenden Komplexität der Satzstrukturen wird nachvollziehbar dargestellt.
Schlüsselwörter
Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Haupt- und Nebensätze, Satzstruktur, Verbzweitstellung, Verbendstellung, Topologisches Feldermodell, Satzklammer, Erwerbsverlauf, Entwicklungsstufen, monolingual, Deutsch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Erwerb von Haupt- und Nebensätzen im Deutschen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Erwerb von Haupt- und Nebensätzen im Erst- und Zweitspracherwerb des Deutschen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des monolingualen Erstspracherwerbs mit verschiedenen Zweitspracherwerbs-Typen (früh, spät, Erwachsene).
Welche Aspekte des Erst- und Zweitspracherwerbs werden behandelt?
Der Text behandelt den Erwerbsverlauf von Satzstrukturen bei monolingualen deutschen Kindern, verschiedene Zweitspracherwerbs-Typen, die sprachwissenschaftlichen Grundlagen von Haupt- und Nebensätzen (inkl. Verbzweitstellung und Verbendstellung, Topologisches Feldermodell und Satzklammer) und die Entwicklungsstufen im kindlichen Erstspracherwerb.
Welche sprachwissenschaftlichen Grundlagen werden erläutert?
Der Text erläutert den Unterschied zwischen Haupt- und Nebensätzen, die unterschiedliche Verbposition (Verbzweitstellung im Hauptsatz, Verbendstellung im Nebensatz) und das topologische Feldermodell als Werkzeug zur Visualisierung der Satzstruktur. Die Besetzung der Satzklammer in Haupt- und Nebensätzen und die asymmetrische Belegung der Satzklammer als grundlegender Unterschied werden hervorgehoben.
Wie wird der Erwerbsverlauf bei monolingualen Kindern beschrieben?
Der Erwerbsverlauf wird anhand der Entwicklungsstufen nach Thoma/Tracy (vier Meilensteine) beschrieben, beginnend bei Einwortäußerungen bis hin zum Erwerb der Verbzweit-Stellung. Herausforderungen und Besonderheiten des kindlichen Spracherwerbs, wie die frühe Erkennung der rechten Satzklammer, werden ebenfalls thematisiert.
Welche Zweitspracherwerbs-Typen werden verglichen?
Der Text vergleicht den Erstspracherwerb mit dem Zweitspracherwerb, wobei früher, später und der Zweitspracherwerb Erwachsener unterschieden und verglichen werden.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu den sprachwissenschaftlichen Grundlagen von Haupt- und Nebensätzen (inkl. Unterkapitel zum Erwerbsverlauf bei monolingualen Kindern und verschiedenen Zweitspracherwerbs-Typen) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Haupt- und Nebensätze, Satzstruktur, Verbzweitstellung, Verbendstellung, Topologisches Feldermodell, Satzklammer, Erwerbsverlauf, Entwicklungsstufen, monolingual, Deutsch.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt auf einen Vergleich des monolingualen Erstspracherwerbs des Deutschen mit verschiedenen Zweitspracherwerbstypen ab, mit Fokus auf die Entwicklung von Haupt- und Nebensätzen.
- Quote paper
- Angelina Marx (Author), 2021, Die Satzstruktur von Haupt- und Nebensätzen im Erst- und Zweitspracherwerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1190895