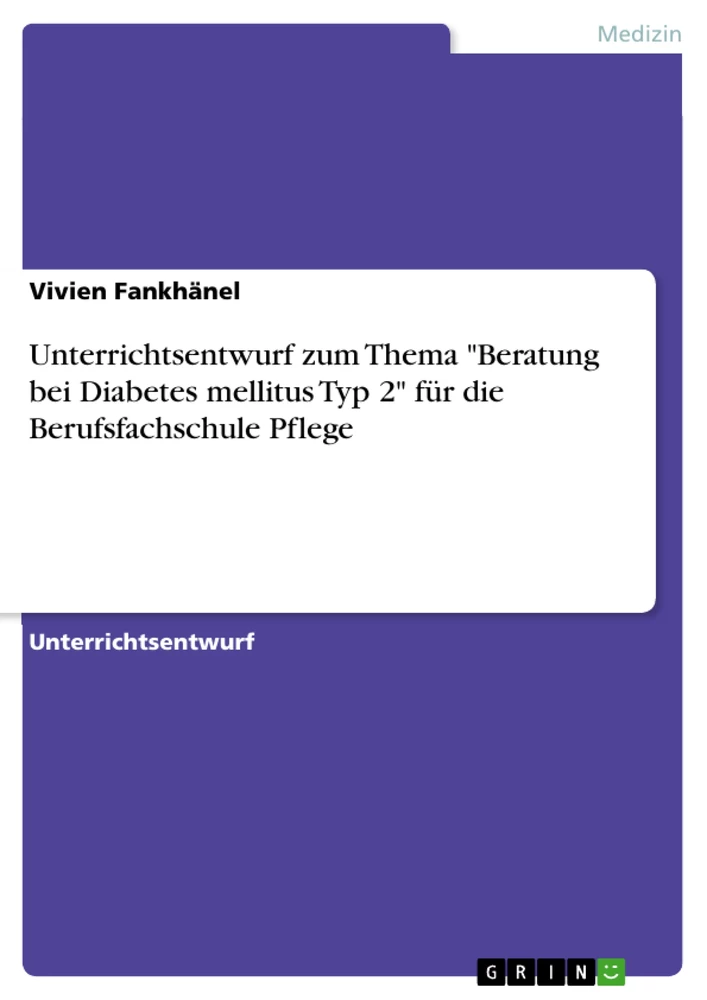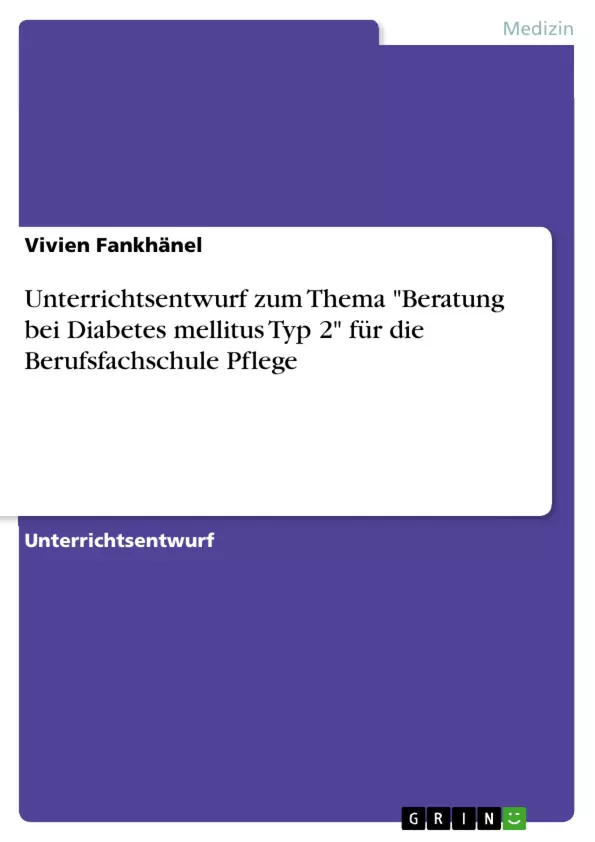Dies ist eine schriftliche Ausarbeitung mit Analyse und Unterrichtsentwurf zum Thema "Beratung bei Diabetes mellitus Typ 2" für die Berufsfachschule Pflege.
Inhaltsverzeichnis
- Rahmenbedingungen/ Bedingungsanalyse
- Institutionsbeschreibung
- Beschreibung der Lerngruppe
- Interesse, Bezug zum Thema
- Ihre Beziehung zur Gruppe
- Einordnung in Lehrplan und Curriculum
- Kontextuierung der Lernsituation im Lernfeld
- Unmittelbar vorausgegangene Lernsituationen
- Erläuterung des Themas in seinem fachwissenschaftlichen Zusammenhang
- Didaktische und methodische Strukturierung
- Inhaltliche Überlegungen und Entscheidungen
- Pflegeprozess
- Didaktische Analyse nach Klafki
- Gegenwartsbedeutung
- Zukunftsbedeutung
- Thematische Strukturierung
- Exemplarische Bedeutung
- Zugänglichkeit
- Selbstpflege-Defizit-Theorie nach Dorothea Orem
- Stundenlernziele
- Der Unterrichtsverlauf
- Tabellarischer Verlauf
- Methodische Begründung der Verlaufsplanung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Unterrichtseinheit soll Auszubildenden in der Pflege die Bedeutung der Gesundheitsförderung als Arbeitsfeld näherbringen. Dabei steht die Beratung von Menschen mit Diabetes mellitus hinsichtlich Ernährung, Bewegung und Blutzuckerregulierung im Fokus. Die Einheit soll den Lernenden ein tieferes Verständnis für die Erkrankung, ihre Auswirkungen und die Rolle der Pflegefachkraft in der Begleitung von Betroffenen vermitteln.
- Das Krankheitsbild Diabetes mellitus und seine Folgen
- Rolle der Pflegefachkraft in der Beratung von Menschen mit Diabetes mellitus
- Zusammenhänge zwischen Ernährung, Bewegung und Blutzuckerregulation
- Einflussfaktoren auf die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes mellitus
- Praktische Umsetzung von Gesundheitsförderung im Pflegealltag
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit den Rahmenbedingungen und einer Analyse der Lerngruppe. Es stellt die Institution, in der der Unterricht stattfindet, vor und beschreibt die Zusammensetzung der Auszubildenden. Auch das Interesse und der Bezug der Lernenden zum Thema Diabetes mellitus werden beleuchtet. Das zweite Kapitel erläutert das Thema Diabetes mellitus in seinem fachwissenschaftlichen Zusammenhang und betrachtet die didaktische und methodische Strukturierung des Unterrichts. Hier werden Inhalte, der Pflegeprozess und die didaktische Analyse nach Klafki sowie die Selbstpflege-Defizit-Theorie nach Dorothea Orem vorgestellt. Außerdem werden die Stundenlernziele für den Unterricht formuliert. Das dritte Kapitel widmet sich dem Unterrichtsverlauf und der methodischen Begründung der Verlaufsplanung. Es enthält einen tabellarischen Verlaufsplan und erläutert die Gründe für die gewählten Methoden. Der vierte Kapitel enthält das Literaturverzeichnis.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter für die Unterrichtseinheit sind: Diabetes mellitus, Gesundheitsförderung, Ernährung, Bewegung, Blutzuckerregulation, Beratung, Pflegeprozess, Selbstpflege-Defizit-Theorie, didaktische Analyse, Unterricht, Lernziele, Verlaufsplanung.
- Arbeit zitieren
- Vivien Fankhänel (Autor:in), 2020, Unterrichtsentwurf zum Thema "Beratung bei Diabetes mellitus Typ 2" für die Berufsfachschule Pflege, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1190558