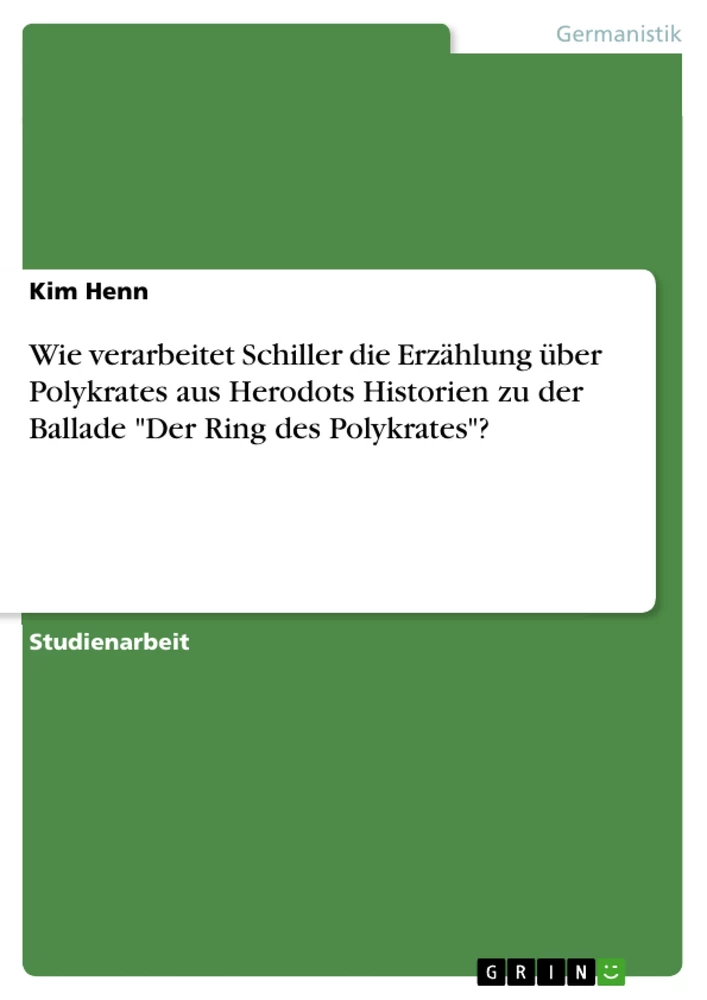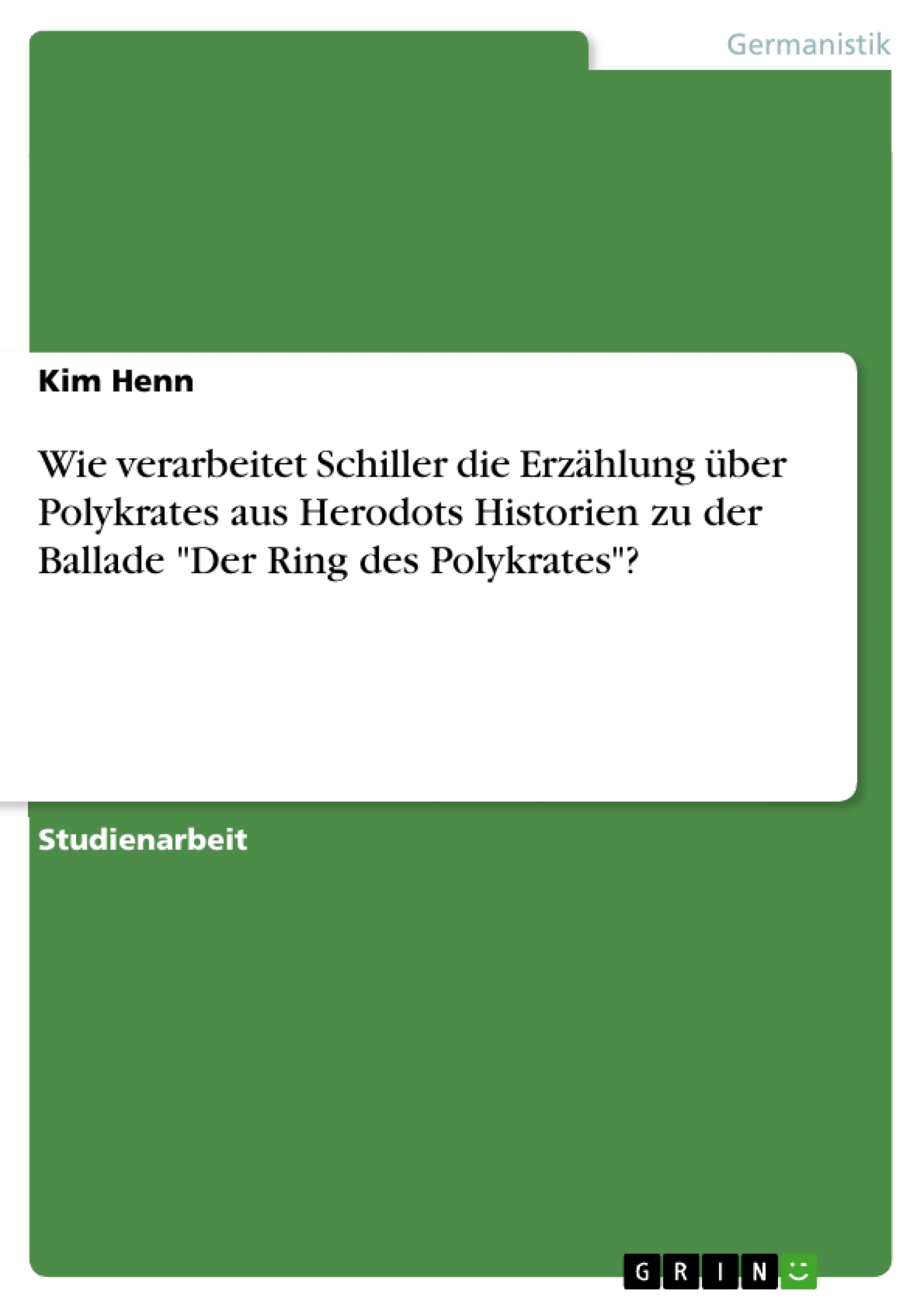Am 24. Juni 1797, im sogenannten Balladenjahr, stellte Schiller die Ballade „Der Ring des Polykrates“ fertig. Diese schickte er an Goethe als „Gegenstück zu Ihren Kranichen“. Der Erstdruck der Ballade findet sich im Musen-Almanach für das Jahr 1798.
In der Ballade greift Schiller die Erzählung über Polykrates und den Ring aus Herodots Historien auf. Diese entnahm Schiller dem dritten Buch (Abschnitt 39-44) in der Übersetzung von Johann Friedrich Degen. Auf diesen Stoff wurde er durch den „2. Teil von Christian Garves Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben“ aufmerksam. In diesem Teil spricht Garve „Ueber zwey Stellen des Herodot“ und nennt die Geschichte des Polykrates als Beispiel für die „Überzeugung der Alten“, dass Menschen, denen das Glück außergewöhnlich gut gesinnt ist, dadurch dem Unglück ausgeliefert sind.
In dieser Seminararbeit soll nun gezeigt werden, wie Schiller die Quelle („Herodots Geschichte“) und die darin enthaltene Thematik des Glücks verarbeitet hat. Dazu werden zunächst die beiden Texte, Schillers „Der Ring des Polykrates“ und Herodots Erzählung über Polykrates und dessen Korrespondenz mit dem ägyptischen König, einzeln vorgestellt. Im Anschluss werden die beiden Texte dann formal und inhaltlich verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine ahistorische Ballade Schillers: „Der Ring des Polykrates“
- Die Problematik des „unbegrenzten Glück[s]“ und die damit verbundenen Konsequenzen am Beispiel eines Tyrannen
- Die Steigerung der Spannung und des Unheimlichen
- Die Quelle: Eine von Herodot überlieferte Erzählung über einen Briefwechsel
- Gestaltung einer Ballade aus dem „,Herodot-Märchen“
- Vom Briefwechsel zum kürzeren, dramatischen Dialog
- „Freie“ Nähe in der Verarbeitung
- Mehrdeutigkeit zu einem gemeinsamen Zweck…
- Fazit: Verkannte Darstellung eines Menschenbildes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht, wie Schiller die Erzählung über Polykrates und den Ring aus Herodots Historien in seiner Ballade „Der Ring des Polykrates“ verarbeitet. Die Arbeit analysiert die formalen und inhaltlichen Unterschiede zwischen Schillers Ballade und der ursprünglichen Quelle, um zu zeigen, wie Schiller die Thematik des Glücks und deren Konsequenzen gestaltet.
- Die Problematik des „unbegrenzten Glücks“ und dessen Folgen
- Die Gestaltung der Spannung und des Unheimlichen in der Ballade
- Der Vergleich zwischen Schillers Ballade und Herodots Erzählung
- Die Darstellung des Menschenbildes in Schillers Ballade
- Die Rolle des Königtums und der „Bestimmung des Menschen“ in der Ballade
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Ballade sowie Schillers Intention bei deren Entstehung dar. Das zweite Kapitel widmet sich der Analyse von Schillers Ballade „Der Ring des Polykrates“ und beleuchtet die Problematik des „unbegrenzten Glücks“ und dessen Auswirkungen auf den Tyrannen Polykrates. Das dritte Kapitel untersucht die Quelle von Schillers Ballade, Herodots Erzählung über Polykrates und seinen Briefwechsel mit dem ägyptischen König. Im vierten Kapitel werden die formalen und inhaltlichen Unterschiede zwischen Schillers Ballade und Herodots Erzählung analysiert. Das Kapitel beleuchtet die Gestaltung der Spannung und des Unheimlichen in der Ballade und untersucht die „freie“ Nähe in der Verarbeitung der Quelle.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen des Glücks und der Nemesis, der Darstellung des Menschenbildes, dem Königtum und der „Bestimmung des Menschen“, dem Vergleich von Texten, der formalen und inhaltlichen Analyse von Balladen, sowie der Untersuchung von Quellen und deren Verarbeitung in literarischen Werken.
- Arbeit zitieren
- Kim Henn (Autor:in), 2019, Wie verarbeitet Schiller die Erzählung über Polykrates aus Herodots Historien zu der Ballade "Der Ring des Polykrates"?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1190332