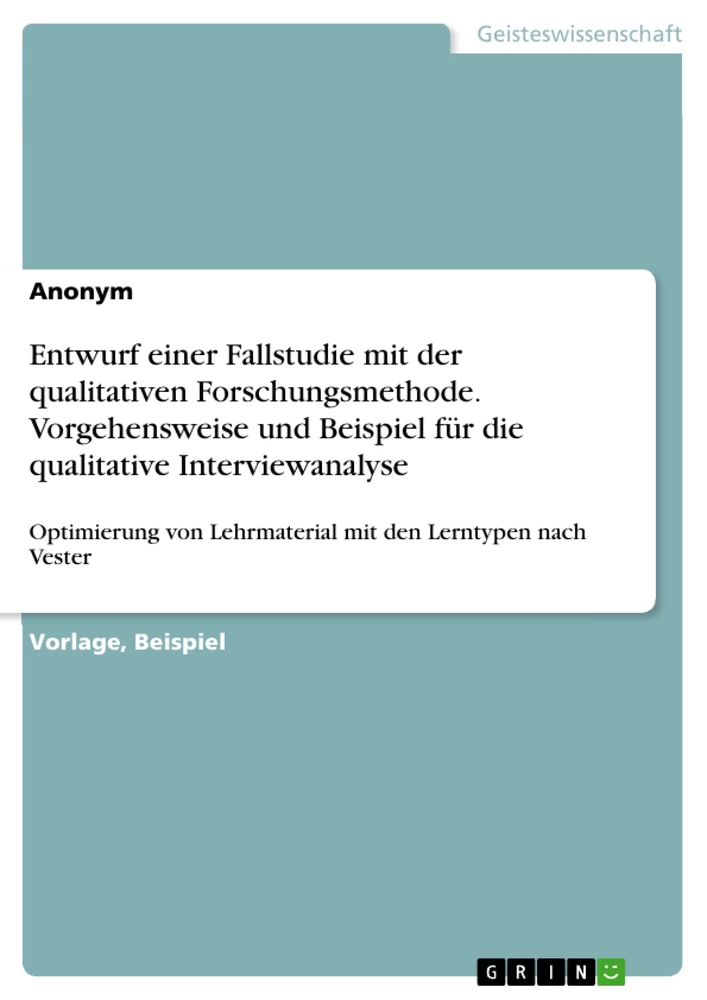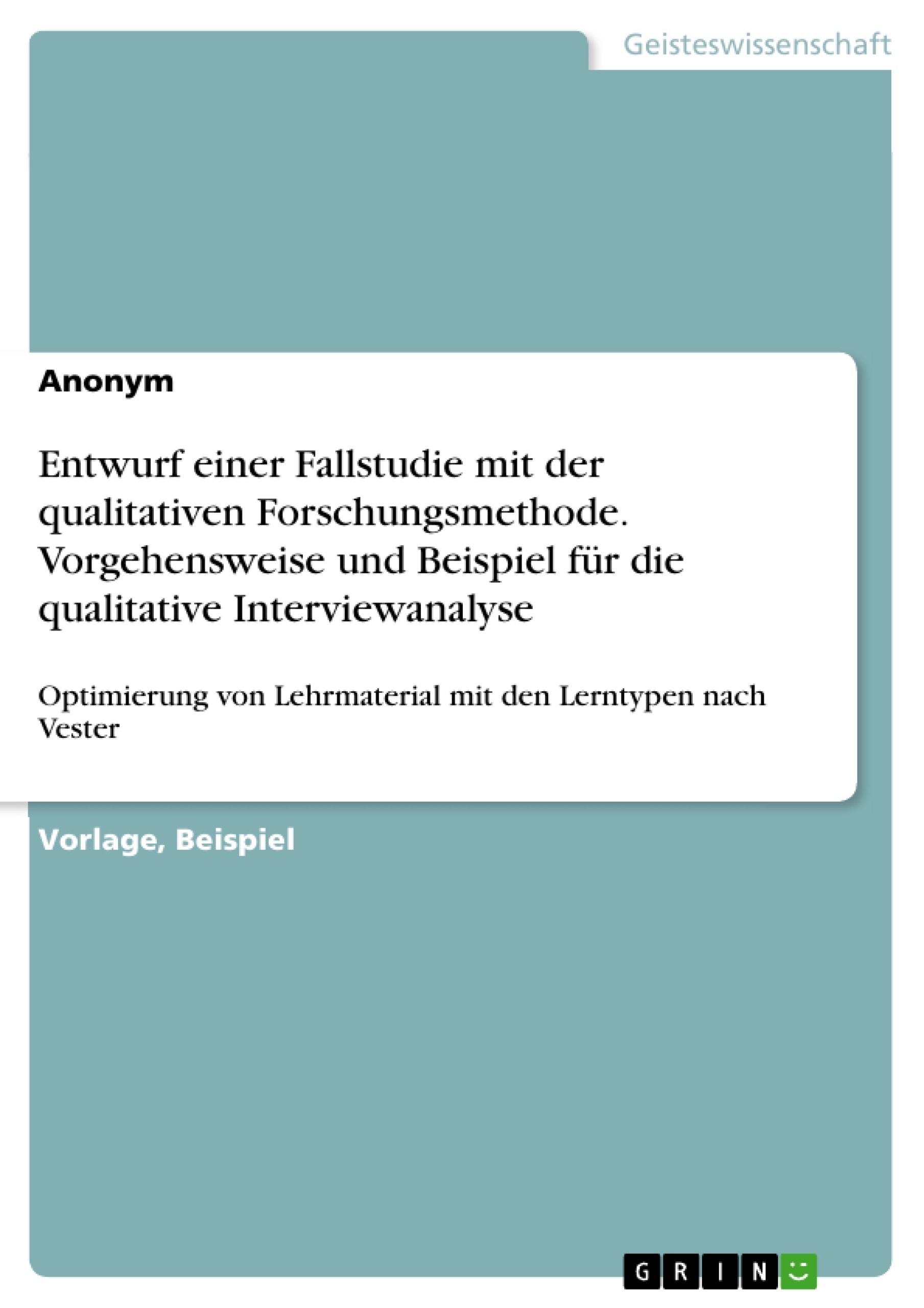Anhand dieser Fallstudie soll der Forschungsprozess zu einer exemplarisch aufgestellten Fragestellung dargestellt werden. Dadurch kann der Leser nachvollziehen, wie die einzelnen Schritte der Fallstudie aufeinander aufbauen und wozu diese dienen.
Zu Beginn der Fallstudie wird auf die Ausgangslage eingegangen, um dem Leser ein besseres Verständnis zu vermitteln, in welchem Zusammenhang die nachfolgend erschlossene Fragestellung konzipiert wurde. Zudem wird das Forschungsfeld der Fallstudie festgelegt. In der Forschungsfrage wird die Begrifflichkeit Lerntyp verwendet, sodass der Begriff und die verschiedenen Arten von Lerntypen vor allen weiteren Erläuterungen in der Fallstudie dargestellt werden. Anschließend erfolgt eine Definition und Begründung der Wahl der qualitativen Sozialforschung sowie der Erhebungsmethode Experteninterviews für die eingangs gestellte Fragestellung.
Dabei wird auf die Vorteile sowie auf den Ablauf des Experteninterviews eingegangen. Danach wird das Sampling des Experteninterviews näher beschrieben. Anhand der festgelegten, grundlegenden Rahmenbedingen zur Beantwortung der Fragestellung wird nun der Interviewleitfaden für die Experteninterviews vorgestellt. Da die Interviews ausgewertet werden müssen, wird das Auswertungsverfahren der qualitativen Inhaltsanalyse in seinen Grundzügen erklärt. Abschließend wird die Fallstudie in die bereits bestehenden Forschungen zu dieser Thematik eingebettet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ausgangslage
- 3. Fragestellung und Forschungsfeld
- 4. Lerntypen im Überblick
- 4.1 Visueller Lerntyp
- 4.2 Auditiver Lerntyp
- 4.3 Haptischer Lerntyp
- 4.4 Kommunikativer Lerntyp
- 5. Methodologische Positionierung
- 6. Erhebungsverfahren
- 7. Auswertungsverfahren
- 8. Sampling
- 9. Grundlagentheoretische Einbettung der Fragestellung in die Forschung
- 10. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Fallstudie untersucht, wie Lehrmaterialien des Fachbereichs „Soziales“ an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe im Hinblick auf verschiedene Lerntypen gestaltet werden müssen, um Studierende, die Vorlesungen nicht besuchen, optimal auf Prüfungen vorzubereiten. Die Studie analysiert den Einfluss der Abschaffung der Anwesenheitspflicht auf das Lernergebnis und zielt darauf ab, Verbesserungsvorschläge für die Gestaltung von Lehrmaterialien zu liefern.
- Einfluss verschiedener Lerntypen auf den Lernerfolg
- Auswirkungen der Abschaffung der Anwesenheitspflicht auf das Studium
- Optimierung von Lehrmaterialien für erfolgreiches Lernen ohne Vorlesungsbesuch
- Qualitative Forschungsmethoden zur Untersuchung der Fragestellung
- Anpassung von Lehrmaterialien an die Bedürfnisse unterschiedlicher Lerntypen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufbau und die Zielsetzung der Fallstudie. Sie erläutert, wie die einzelnen Schritte des Forschungsprozesses aufeinander aufbauen und dient dem Leser als Orientierungshilfe. Es wird ein Überblick über die Ausgangslage, die Forschungsfrage und die verwendeten Methoden gegeben. Die Bedeutung des Lerntypen-Konzepts wird hervorgehoben, und die Wahl der qualitativen Sozialforschung und der Methode der Experteninterviews wird begründet.
2. Ausgangslage: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext der Fallstudie: Die Abschaffung der Anwesenheitspflicht an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe vor zwei Jahren. Es werden die Gründe für diese Entscheidung erläutert, einschließlich der vorherigen gescheiterten Versuche, den Hochschulstandort attraktiver zu gestalten. Die Herausforderung für die Hochschule, Lehrmaterialien für 15.000 Studierende anzupassen und zu optimieren, wird hervorgehoben, sowie der gleichbleibende Leistungsstand der Studierenden trotz der Abschaffung der Anwesenheitspflicht. Der Fokus auf die Optimierung der Lehrmaterialien im Fachbereich „Soziales“ wird als nächster Schritt zur Verbesserung des Notendurchschnitts dargestellt.
3. Fragestellung und Forschungsfeld: Dieses Kapitel definiert die zentrale Forschungsfrage: Wie müssen Lehrmaterialien des Fachbereichs „Soziales“ der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe im Hinblick auf unterschiedliche Lerntypen aufgebaut werden, um Studierende, die die Vorlesungen nicht besuchen, bestmöglich auf Prüfungen vorzubereiten? Das Forschungsfeld wird als die Personengruppe der Studierenden an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe eingegrenzt. Die Verbindung zwischen Fragestellung und Forschungsfeld wird betont, um eine spezifische Fokussierung des Forschungsprozesses zu gewährleisten.
4. Lerntypen im Überblick: Kapitel 4 stellt verschiedene Lerntypen nach Frederic Vester vor: den visuellen, auditiven, haptischen und kommunikativen Lerntyp. Jeder Lerntyp wird kurz definiert und seine spezifischen Lernmethoden und Präferenzen beschrieben. Die Bedeutung der Berücksichtigung verschiedener Lerntypen für effektives Lernen wird hervorgehoben. Die Möglichkeit, dass eine Person mehreren Lerntypen angehören kann, wird ebenfalls erwähnt.
5. Methodologische Positionierung: Dieses Kapitel rechtfertigt die Wahl der qualitativen Sozialforschung zur Beantwortung der Forschungsfrage. Die Vorteile und die Eignung dieser Methode für die Untersuchung komplexer Zusammenhänge werden erläutert. Der Fokus liegt auf der Erfassung unterschiedlicher Perspektiven und der Interpretation der gewonnenen Erkenntnisse. Die Offenheit für neue Erkenntnisse und die Notwendigkeit der Reflexivität gegenüber empirischen Methoden werden betont.
Schlüsselwörter
Lerntypen, Qualitative Sozialforschung, Experteninterviews, Hochschuldidaktik, Lehrmaterialgestaltung, Anwesenheitspflicht, Digitalisierung, Studierenderfolg, Hochschule Ostwestfalen-Lippe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Fallstudie: Gestaltung von Lehrmaterialien für verschiedene Lerntypen an der TH OWL
Was ist das Thema der Fallstudie?
Die Fallstudie untersucht, wie Lehrmaterialien des Fachbereichs „Soziales“ an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) gestaltet werden müssen, um Studierende, die Vorlesungen nicht besuchen, optimal auf Prüfungen vorzubereiten. Im Mittelpunkt steht der Einfluss der Abschaffung der Anwesenheitspflicht auf das Lernergebnis und die Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen für die Gestaltung von Lehrmaterialien.
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie müssen Lehrmaterialien des Fachbereichs „Soziales“ der TH OWL im Hinblick auf unterschiedliche Lerntypen aufgebaut werden, um Studierende, die die Vorlesungen nicht besuchen, bestmöglich auf Prüfungen vorzubereiten?
Welche Lerntypen werden betrachtet?
Die Studie betrachtet verschiedene Lerntypen nach Frederic Vester: den visuellen, auditiven, haptischen und kommunikativen Lerntyp. Jeder Lerntyp wird hinsichtlich seiner spezifischen Lernmethoden und Präferenzen untersucht.
Welche Methode wird angewendet?
Es wird qualitative Sozialforschung eingesetzt, um die komplexe Fragestellung zu untersuchen. Die Methode der Experteninterviews ermöglicht die Erfassung unterschiedlicher Perspektiven und die Interpretation der gewonnenen Erkenntnisse.
Welche Aspekte werden in der Studie analysiert?
Die Studie analysiert den Einfluss verschiedener Lerntypen auf den Lernerfolg, die Auswirkungen der Abschaffung der Anwesenheitspflicht auf das Studium und die Möglichkeiten zur Optimierung von Lehrmaterialien für erfolgreiches Lernen ohne Vorlesungsbesuch. Die Anpassung von Lehrmaterialien an die Bedürfnisse unterschiedlicher Lerntypen spielt eine zentrale Rolle.
Wie ist die Fallstudie aufgebaut?
Die Fallstudie umfasst eine Einleitung, die die Ausgangslage, die Forschungsfrage und die Methodik beschreibt. Es folgen Kapitel zur Ausgangslage, zur Fragestellung und zum Forschungsfeld, eine Übersicht über Lerntypen, die methodologische Positionierung, die Beschreibung der Erhebungs- und Auswertungsverfahren sowie ein Fazit. Kapitelüberschriften und -zusammenfassungen bieten eine detaillierte Orientierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Lerntypen, Qualitative Sozialforschung, Experteninterviews, Hochschuldidaktik, Lehrmaterialgestaltung, Anwesenheitspflicht, Digitalisierung, Studierenderfolg, Hochschule Ostwestfalen-Lippe.
Wo findet man weitere Informationen?
Die detaillierten Ergebnisse der Studie sind im vollständigen Text enthalten (hier nicht vollständig wiedergegeben). Dieser beinhaltet das vollständige Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen und eine ausführlichere Darstellung der Methodik und Ergebnisse.
Welche Bedeutung hat die Abschaffung der Anwesenheitspflicht für die Studie?
Die Abschaffung der Anwesenheitspflicht an der TH OWL vor zwei Jahren bildet den Ausgangspunkt der Studie. Sie stellt eine zentrale Herausforderung dar, da sie die Notwendigkeit zur Optimierung der Lehrmaterialien für Studierende hervorhebt, die nicht an Vorlesungen teilnehmen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, Verbesserungsvorschläge für die Gestaltung von Lehrmaterialien zu liefern, um den Lernerfolg von Studierenden, die Vorlesungen nicht besuchen, zu verbessern. Sie möchte den Einfluss der Abschaffung der Anwesenheitspflicht auf das Lernergebnis untersuchen und Handlungsempfehlungen für die Hochschullehre ableiten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Entwurf einer Fallstudie mit der qualitativen Forschungsmethode. Vorgehensweise und Beispiel für die qualitative Interviewanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1190084