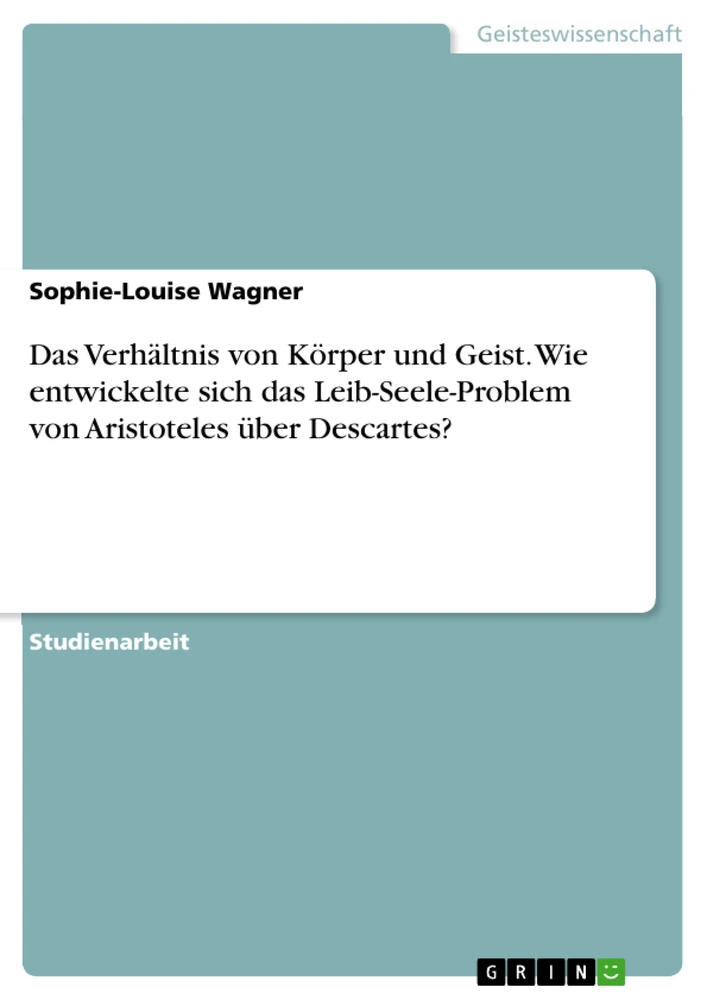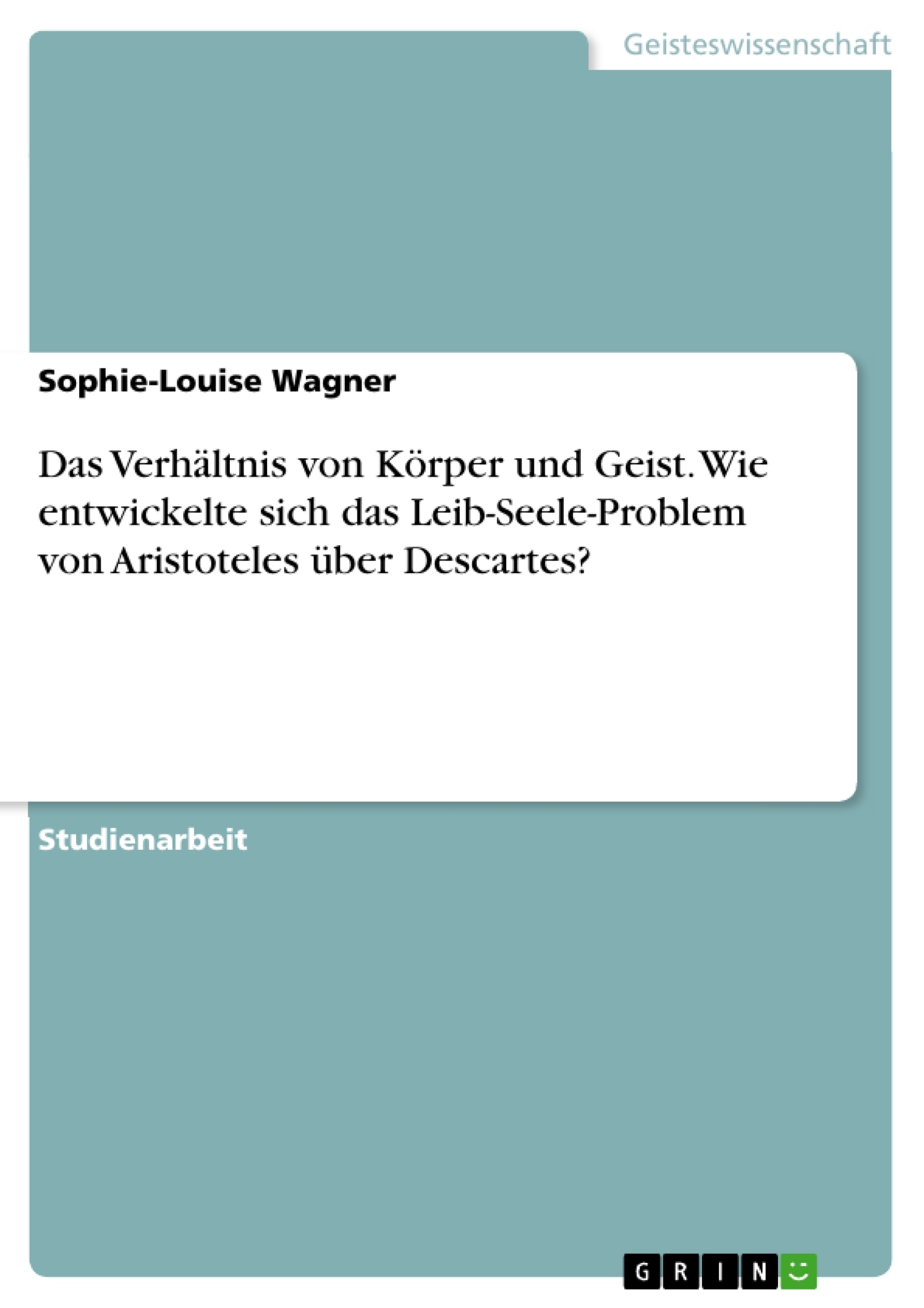Wir erröten, wenn wir uns schämen. Unser Blutdruck steigt, wenn wir zornig sind. Die Einnahme von Drogen ruft bestimmte Erlebnisse hervor und Hirnverletzungen können zu kognitiven Ausfällen führen. Diese Phänomene zeigen, dass der Körper und unser Geist/unsere Seele in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen müssen.
Gegenstand dieser Hausarbeit ist es, sich mit diesem Verhältnis von Körper und Geist auseinanderzusetzen. Die zentrale Frage des Leib-Seele-Problems, wie sich mentale Zustände zu den physischen Zuständen verhalten, ist bis heute eine sehr umstrittene Frage der Philosophie des Geistes.
Das Ziel dieser Arbeit ist es aufzuweisen, wie aus der Frage, nach der Beziehung zwischen Körper und Geist, das Leib-Seele-Problem resultierte. Hierzu wird zunächst einmal das Leib-Seele-Problem dargestellt. Es soll verdeutlicht werden, dass die erste klassische Formulierung des Leib-Seele-Problems ihren Ursprung bei dem französischen Philosophen René Descartes findet. Deshalb wird bei der erkenntnistheoretischen Problematik angesetzt, aus welcher resultierte, dass Descartes sich für die Existenz einer geistigen Substanz, die differenziert von der des Körpers zu betrachten gilt, positioniert.
Die zwei verschiedenen Substanzen "res cogitans" und "res extensa" und die Annahme einer kausalen Interaktion sollen anschließend genauer beleuchtet werden. Das Nachdenken über den Zusammenhang von Körper und Geist geht dennoch bis in die Antike zurück. Bereits Aristoteles beschäftigte sich mit dieser Fragestellung, allerdings musste er sich mit seiner Seelenlehre nie den Problematiken stellen, wie es beispielsweise Descartes als Vertreter des Dualismus musste. Dies soll verdeutlicht werden, indem zunächst die aristotelische Seelenlehre dargestellt und auf seine Konzeption des Hylemorphismus eingegangen wird.
Im nächsten Schritt soll das Verhältnis von Körper und Geist nach Aristoteles erläutert und schließlich auf eine Ausnahme des Hylemorphismus eingegangen werden. Die theoretischen Überlegungen zu dem cartesischen Dualismus, sowie zu dem aristotelischen Hylemorphismus werden anschließend zusammengeführt. Hier sollen beide Perspektiven nochmals gegenübergestellt und die gravierenden Unterschiede zusammenfassend betont werden. Zum Schluss werden die zentralen Punkte dieser Arbeit komprimiert und eine prägnante Antwort auf die zugrunde liegende Frage der Arbeit formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Leib-Seele-Problem
- Das dualistische Verhältnis von Leib und Seele nach René Descartes
- Das erkenntnistheoretische Problem
- Die zwei verschiedenen Substanzen „res cogitans“ und „res extensa“
- Die kausale Verbindung der zwei Substanzen „res cogitans“ und „res extensa“
- Die Problematik des interaktionistischen Dualismus nach Descartes
- Der aristotelische Hylemorphismus als Gegenpol zu dem cartesischen Dualismus
- Die Seele als das Prinzip des Lebens
- Das Verhältnis von Körper und Seele nach dem aristotelischen Hylemorphismus
- Die Ausnahme des aristotelischen Hylemorphismus
- Ein Vergleich der zwei verschiedenen Perspektiven
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Verhältnis von Körper und Geist, insbesondere die Entwicklung des Leib-Seele-Problems von Aristoteles bis Descartes. Das Ziel ist es aufzuzeigen, wie aus der Frage nach der Beziehung zwischen Körper und Geist das Leib-Seele-Problem entstand.
- Das Leib-Seele-Problem: Definition und historische Entwicklung
- Der cartesische Dualismus: Geist und Körper als getrennte Substanzen
- Der aristotelische Hylemorphismus: Geist und Körper als Prinzipien derselben Substanz
- Vergleich des cartesischen Dualismus und des aristotelischen Hylemorphismus
- Die Problematik des interaktionistischen Dualismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Verhältnisses von Körper und Geist ein und stellt anhand von Beispielen (Erröten, Blutdrucksteigerung, Drogenwirkung, Hirnverletzungen) die Verbindung zwischen physischen und mentalen Zuständen heraus. Sie definiert das Leib-Seele-Problem als zentrale Fragestellung und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Entwicklung des Problems von der Antike (Aristoteles) bis zur Neuzeit (Descartes) nachzeichnet.
2. Das Leib-Seele-Problem: Dieses Kapitel klärt zunächst die Begriffe „Leib“ und „Seele“ und begründet die Verwendung von „Körper-Geist“ als präziserer Ausdruck. Es beschreibt das Leib-Seele-Problem als die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Körper und Geist und skizziert den historischen Kontext, in dem Aristoteles' hylemorphistische Sichtweise zunächst vorherrschte, bevor Descartes' Dualismus das Problem neu formulierte. Die Unvereinbarkeit des hylemorphistischen Weltbildes mit dem aufkommenden mathematisch-physikalischen Weltbild wird als wichtiger Hintergrund für die Entwicklung des Problems dargestellt.
3. Das dualistische Verhältnis von Leib und Seele nach René Descartes: Dieses Kapitel widmet sich Descartes' interaktionistischem Dualismus. Es erläutert Descartes' methodische Skepsis und seinen Weg zur Begründung der Existenz einer immateriellen, denkenden Substanz (res cogitans), getrennt von der materiellen, ausgedehnten Substanz (res extensa). Die Kapitel 3.1 bis 3.4 würden hier im Detail die erkenntnistheoretischen Grundlagen, die Unterscheidung der Substanzen, die kausale Interaktion und die Probleme des Dualismus erläutern. Der Fokus liegt auf Descartes' Beitrag zur Formulierung des Leib-Seele-Problems als Folge seiner dualistischen Metaphysik.
4. Der aristotelische Hylemorphismus als Gegenpol zu dem cartesischen Dualismus: Dieses Kapitel präsentiert Aristoteles' hylemorphistische Sichtweise als Gegenmodell zum cartesischen Dualismus. Es erklärt die Seele als Prinzip des Lebens und das Verhältnis von Körper und Seele innerhalb dieser hylemorphistischen Philosophie. Die Kapitel 4.1 bis 4.3 würden hier den aristotelischen Ansatz detailliert darlegen und auch auf mögliche Ausnahmen oder Limitationen dieser Theorie eingehen. Der Kontrast zu Descartes' Dualismus wird hervorgehoben, um die unterschiedlichen philosophischen Ansätze zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Leib-Seele-Problem, Körper-Geist, René Descartes, Dualismus, Interaktionismus, Aristoteles, Hylemorphismus, Erkenntnistheorie, Substanz, Materie, Geist, Res cogitans, Res extensa, Mentale Zustände, Physische Zustände.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Leib-Seele-Problem
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Verhältnis von Körper und Geist, insbesondere die Entwicklung des Leib-Seele-Problems von Aristoteles bis Descartes. Sie zeigt auf, wie aus der Frage nach der Beziehung zwischen Körper und Geist das Leib-Seele-Problem entstand.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das Leib-Seele-Problem, seine Definition und historische Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen der cartesische Dualismus mit Geist und Körper als getrennte Substanzen und der aristotelische Hylemorphismus, der Geist und Körper als Prinzipien derselben Substanz betrachtet. Ein Vergleich beider Ansätze und die Problematik des interaktionistischen Dualismus werden ebenfalls diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das Leib-Seele-Problem, Das dualistische Verhältnis von Leib und Seele nach René Descartes (mit Unterkapiteln zur Erkenntnistheorie, den Substanzen „res cogitans“ und „res extensa“, deren kausaler Verbindung und den Problemen des Dualismus), Der aristotelische Hylemorphismus als Gegenpol zum cartesischen Dualismus (mit Unterkapiteln zur Seele als Lebensprinzip, dem Verhältnis von Körper und Seele im Hylemorphismus und Ausnahmen/Limitationen), Ein Vergleich der zwei verschiedenen Perspektiven und Fazit.
Wie wird der cartesische Dualismus dargestellt?
Der cartesische Dualismus wird als eine Trennung von immaterieller, denkender Substanz („res cogitans“) und materieller, ausgedehnter Substanz („res extensa“) erläutert. Die Arbeit beleuchtet Descartes' methodische Skepsis und seinen Weg zur Begründung dieses Dualismus sowie die damit verbundenen erkenntnistheoretischen Grundlagen und die Problematik der kausalen Interaktion zwischen beiden Substanzen.
Wie wird der aristotelische Hylemorphismus dargestellt?
Der aristotelische Hylemorphismus wird als Gegenmodell zum cartesischen Dualismus präsentiert. Die Seele wird als Prinzip des Lebens verstanden, und das Verhältnis von Körper und Seele wird im Kontext der hylemorphistischen Philosophie erklärt. Die Arbeit beleuchtet den aristotelischen Ansatz detailliert und diskutiert mögliche Ausnahmen oder Limitationen dieser Theorie.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel der Hausarbeit ist es aufzuzeigen, wie aus der Frage nach der Beziehung zwischen Körper und Geist das Leib-Seele-Problem entstand und die unterschiedlichen philosophischen Ansätze von Aristoteles und Descartes zu diesem Problem zu vergleichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Leib-Seele-Problem, Körper-Geist, René Descartes, Dualismus, Interaktionismus, Aristoteles, Hylemorphismus, Erkenntnistheorie, Substanz, Materie, Geist, Res cogitans, Res extensa, Mentale Zustände, Physische Zustände.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und den Aufbau der Arbeit skizziert. Es folgen Kapitel, die das Leib-Seele-Problem, den cartesischen Dualismus und den aristotelischen Hylemorphismus detailliert erläutern. Ein Vergleich der beiden Perspektiven und ein Fazit schließen die Arbeit ab. Kapitelzusammenfassungen und ein Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls enthalten.
- Quote paper
- Sophie-Louise Wagner (Author), 2021, Das Verhältnis von Körper und Geist. Wie entwickelte sich das Leib-Seele-Problem von Aristoteles über Descartes?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1189933