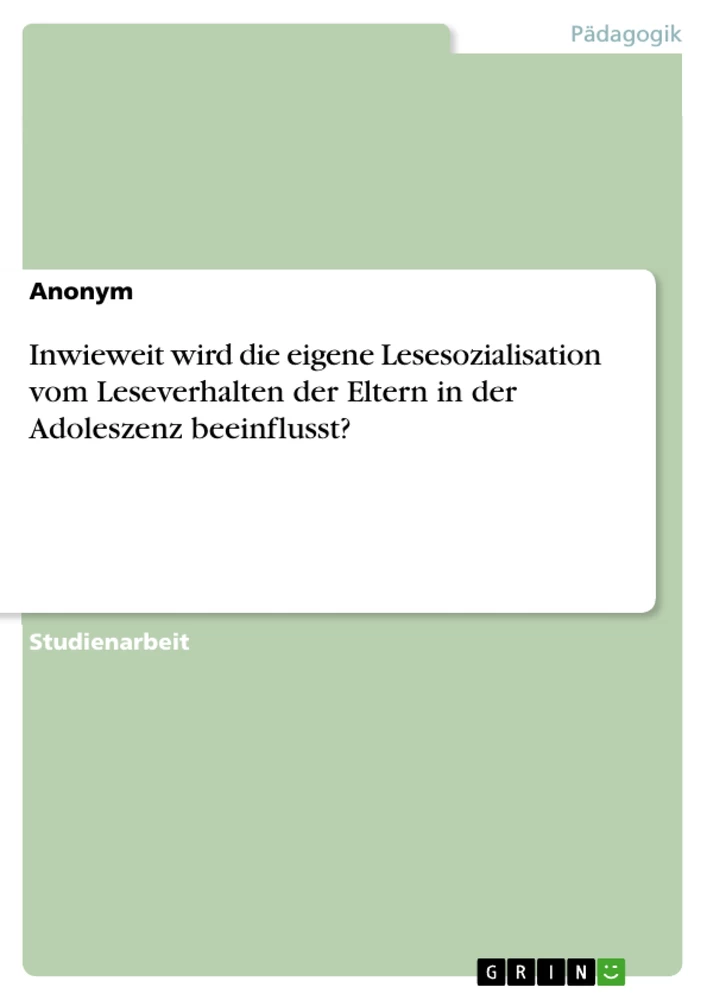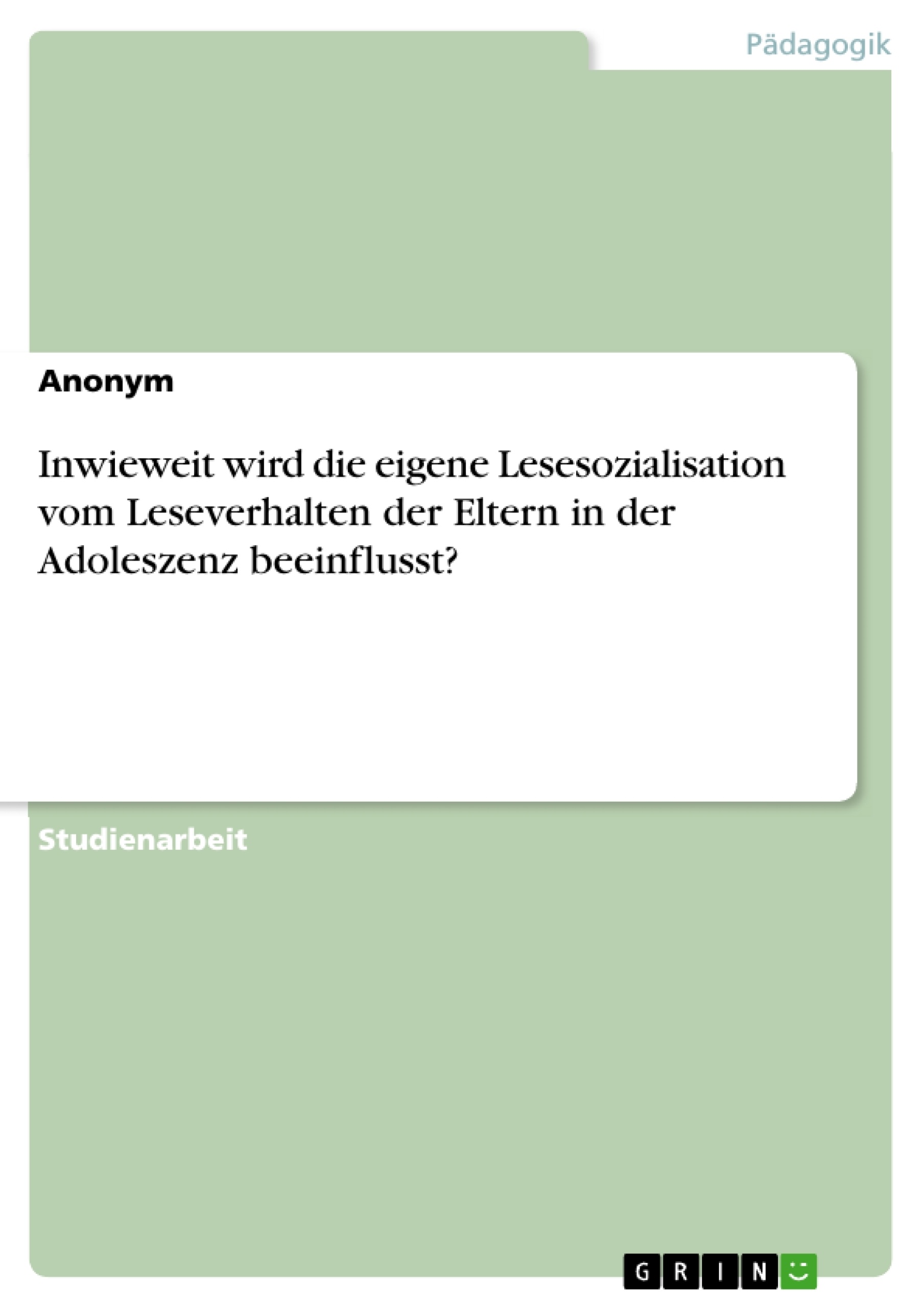Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwieweit die eigene Lesesozialisation vom Leseverhalten der Eltern in der Adoleszenz beeinflusst wird.
Hurrelmann versteht das Lesen als einen wichtigen Teil der Sozialisierung, als Erwerb der Fähigkeit, schriftliches Material zu entschlüsseln, aber gleichzeitig auch Kommunikationsinteressen und kulturelle Einstellungen, die dem Leser ermöglichen, an dem sozialen und kulturellen Leben einer buchstäblich modellierten Kultur teilzunehmen.
Damit bringt Hurrelmann die herausragende Bedeutung des Lesens in unserer heutigen Gesellschaft zum Ausdruck. Um eine entsprechende Lesekompetenz zu erwerben, ist ein Austausch mit anderen kompetenten Personen erforderlich sowie das Vermitteln von kulturellem Wissen und die Unterstützung im Leseprozess. Dies schließt Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule und Peers ein. Auf diese beiden Befunde wird im Laufe dieser Arbeit eingegangen und das Modell von Hurrelmann näher beleuchtet.
Die persönliche Leseautobiografie der Autorin wird erläutert, kritisch reflektiert und es wird sich damit befasst, was das Lesen literarischer Texte umfasst. Die Literaturauswahl wurde angepasst, um ein allgemeines Verständnis des Leseverhaltens und seiner bestimmenden Faktoren zu erlangen. Im weiteren Verlauf wird chronologisch und induktiv vorgegangen, um eine entsprechende Struktur zu erhalten und die eigenen Erfahrungen im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse zu betrachten. Diese Hypothese wird überprüft, reflektiert und im Fazit wieder aufgegriffen.
Als angehende Lehrkraft ist es notwendig, sich mit der eigenen Lesegeschichte zu befassen, entsprechende Verhaltensmuster zu identifizieren und diese Erkenntnisse in die tägliche Arbeit mit den Lernenden einfließen zu lassen. Was sowohl für bekannte Defizite gilt als auch in einen als positiv zu bewertenden Kontext einzuordnen ist. Die Schule und die Arbeit der Lehrkräfte sind von grundlegender Bedeutung für die individuelle Entwicklung, der Lesesozialisierung der Schüler*innen.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Die Lesesozialisation
- Primäre literarische Initiation
- Persönliche Lesekrise und sekundäre literarische Initiation
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der eigenen Lesesozialisation und der Frage, inwieweit diese vom Leseverhalten der Eltern in der Adoleszenz beeinflusst wurde. Sie untersucht die persönliche Leseautobiographie, reflektiert die Bedeutung des Lesens literarischer Texte und betrachtet die Rolle der Lesesozialisationsinstanzen wie Familie, Schule und Peers.
- Die Bedeutung des Lesens für die Sozialisierung
- Der Einfluss des Familienklimas auf die Lesesozialisation
- Die Rolle der Schule in der Lesesozialisation
- Das Konzept der primären und sekundären literarischen Initiation
- Die verschiedenen Lesertypen nach Hurrelmann
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung
Dieses Kapitel definiert die Bedeutung des Lesens im Kontext der Sozialisation, insbesondere im Hinblick auf Hurrelmanns Modell. Es stellt die Fragestellung der Arbeit vor und skizziert die Methode der persönlichen Leseautobiographie.
Die Lesesozialisation
Dieses Kapitel erläutert die Schlüsselbegriffe der Lesesozialisation, insbesondere die literarische Sozialisation, das Leseverhalten und das Familienklima. Es stellt Hurrelmanns Mehrebenenmodell vor und beschreibt die verschiedenen Lesertypen.
Primäre literarische Initiation
Dieses Kapitel befasst sich mit den Leseerfahrungen der Autorin in der Kindheit und Jugend. Es analysiert die Rolle der Vorlese- und Erzählsituationen in der Familie sowie die Bedeutung der Schule und der Peer Group.
Schlüsselwörter
Lesesozialisation, literarische Sozialisation, Leseverhalten, Familienklima, primäre und sekundäre literarische Initiation, Hurrelmanns Mehrebenenmodell, Lesertypen, Familienaktivitäten, Schule, Peer Group.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Inwieweit wird die eigene Lesesozialisation vom Leseverhalten der Eltern in der Adoleszenz beeinflusst?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1187596