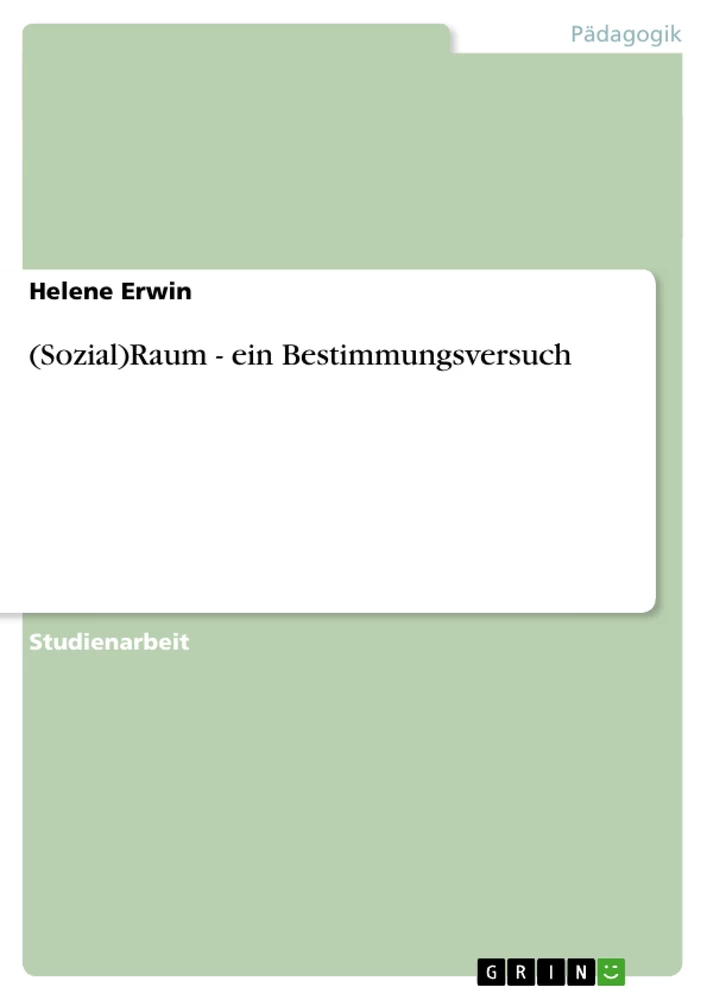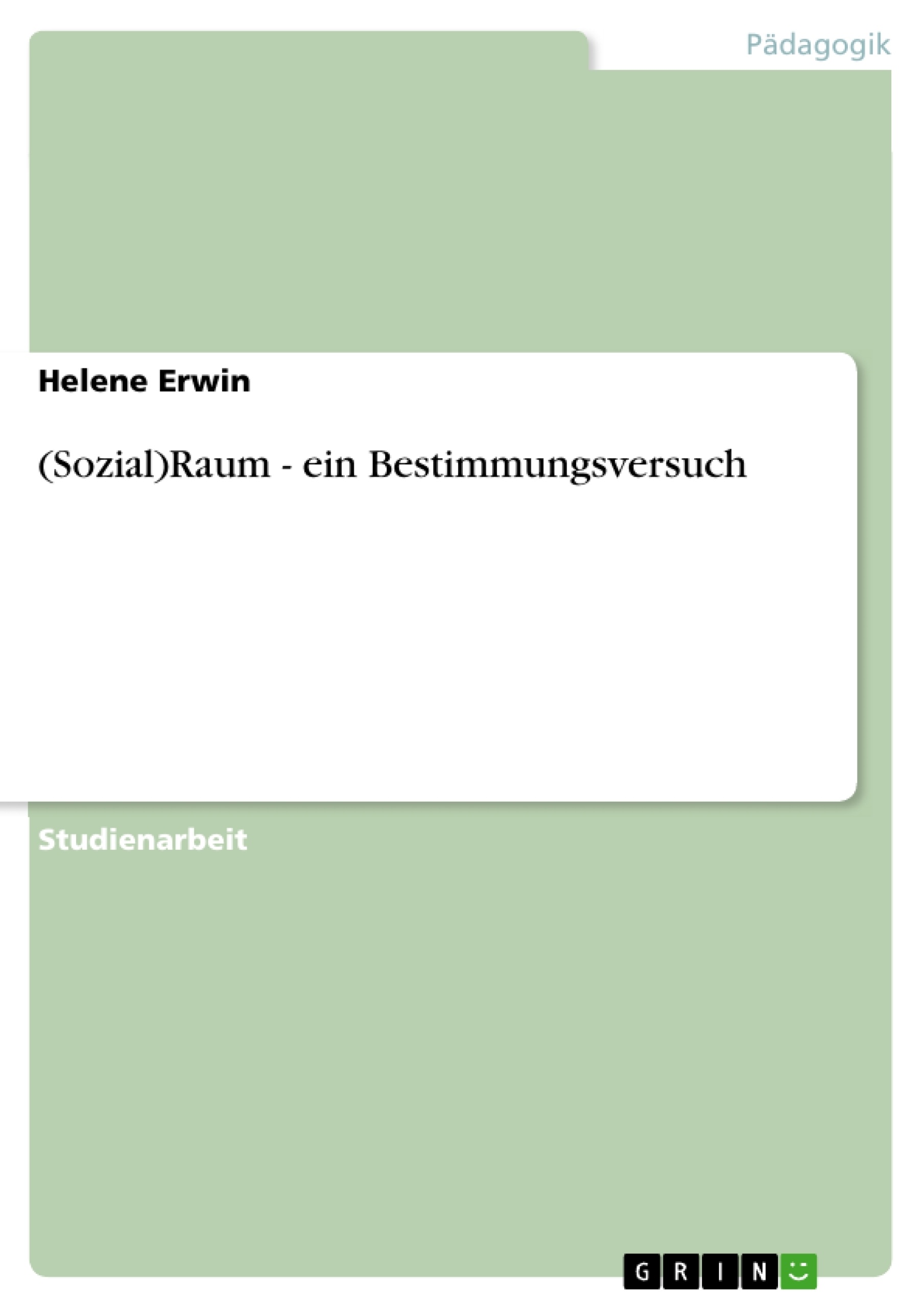Im Allgemeinen wird unter einem Raum etwas verstanden, das, wie ein Hohlmaß,
mathematisch und physikalisch ermittelt werden kann und durch die Höhen-, Längen- und
Breitenangaben bestimmt ist. Der Wirklichkeitsbegriff des Raumes wird also dargestellt, da
die Definition dazu eine fixierte Einheit beschreibt, die kontextunabhängig ist. Dass der Raum
aber „eine an den Menschen und seine Kultur gebundene ,Dimension' sei“, wird von der
Gesellschaft größtenteils geleugnet.
Der mittelhochdeutsche Wortursprung des Begriffs Raum weißt jedoch auch „einestheils [auf]
die bedeutung des freien platzes und der weite mit ihren ausläufern“ hin. Der hier erwähnte
freie Platz ist nicht gezwungenermaßen als Örtlichkeit zu verstehen, sondern kann auch unter
einem sozialen Aspekt gesehen werden, auf den im Folgenden näher eingegangen wird..
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Raum-Begriff im Allgemeinen und speziell in den Sozialwissenschaften
- 1.1 Der absolute und der relative Raum
- 1.2 Der Sozialraum und der Raum
- 1.3 Die natürliche und die konstruierte Raumordnung
- 2. Was verbindet den Sozialraum mit der Sozialen Arbeit?
- 2.1 Die Sozialraumorientierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Raumbegriff, insbesondere im Kontext der Sozialwissenschaften und Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf Raum – den absoluten und relativen Raum – und analysiert die Beziehung zwischen Raum und Sozialraum. Ein zentrales Anliegen ist es, die Bedeutung des Sozialraums für die Soziale Arbeit zu verdeutlichen.
- Der Raumbegriff in den Sozialwissenschaften
- Unterscheidung zwischen absolutem und relativem Raum
- Der Sozialraum als Konstruktion menschlichen Handelns
- Beziehung zwischen Sozialraum und Sozialer Arbeit
- Konstruktivistische und materialistische Raumtheorien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Raum-Begriff im Allgemeinen und speziell in den Sozialwissenschaften: Dieses Kapitel beginnt mit einer allgemeinen Definition des Raumbegriffs, der zunächst mathematisch und physikalisch betrachtet wird, als eine messbare Einheit, unabhängig vom Kontext. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese rein objektive Betrachtungsweise die soziale und kulturelle Eingebundenheit des Raumes vernachlässigt. Der Kapitel vergleicht den Raumbegriff mit dem mittelhochdeutschen Verständnis von "freiem Platz", der auch soziale Aspekte implizieren kann. Die Arbeit bezieht dann Immanuel Kants Raumbegriff mit ein, der als relational und subjektiv betrachtet wird. Im Kontrast zu der objektiven Definition wird der Raum als eine subjektive, vom Beobachter abhängige Größe charakterisiert. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Betrachtung des Sozialraumes, indem es die unterschiedlichen Perspektiven auf den Raumbegriff aufzeigt und dessen Kontextgebundenheit betont. Die Ausführungen über den absoluten und relativen Raum bilden eine Brücke zur sozialwissenschaftlichen Perspektive.
2. Was verbindet den Sozialraum mit der Sozialen Arbeit?: Dieses Kapitel fokussiert auf die Verbindung zwischen Sozialraum und Sozialer Arbeit. Es wird der Begriff der Sozialraumorientierung erläutert und analysiert, wie der Sozialraum durch menschliches Handeln konstruiert wird. Der Unterschied zwischen der Betrachtung des Raumes als Objekt (absoluter Raum) und der Betrachtung der sozialen Beziehungen und Interaktionen im Raum (Sozialraum) wird deutlich herausgestellt. Die Arbeit untersucht die Bedeutung des relationalen Raumbegriffs im Kontext der Sozialen Arbeit, in dem soziale Beziehungsstrukturen und die ungleiche Machtausübung bei der Gestaltung von Sozialräumen berücksichtigt werden. Das Kapitel vergleicht die konstruktivistische und materialistische Raumtheorie und plädiert für einen integrativen Ansatz, welcher beide Perspektiven vereint.
Schlüsselwörter
Raum, Sozialraum, Sozialraumorientierung, absolute Raumvorstellung, relative Raumvorstellung, Soziale Arbeit, Konstruktivismus, Materialismus, Raumordnung, soziale Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Unbekannter Text (Titel fehlt im bereitgestellten HTML)
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Der Text untersucht den Raumbegriff, insbesondere im Kontext der Sozialwissenschaften und Sozialen Arbeit. Er analysiert unterschiedliche Raumvorstellungen (absoluter und relativer Raum), die Beziehung zwischen Raum und Sozialraum und die Bedeutung des Sozialraums für die Soziale Arbeit.
Welche Raumbegriffe werden behandelt?
Der Text behandelt den absoluten und relativen Raum. Der absolute Raum wird als messbare, objektive Einheit definiert, während der relative Raum eine subjektive, vom Beobachter abhängige Größe darstellt. Der Text vergleicht diese mit dem mittelhochdeutschen Verständnis von Raum und bezieht Immanuel Kants Raumbegriff mit ein.
Was ist der Sozialraum und seine Bedeutung für Soziale Arbeit?
Der Sozialraum wird als eine Konstruktion menschlichen Handelns verstanden, in dem soziale Beziehungen und Interaktionen im Mittelpunkt stehen. Der Text analysiert die Sozialraumorientierung und deren Bedeutung für die Soziale Arbeit, wobei die ungleiche Machtausübung bei der Gestaltung von Sozialräumen berücksichtigt wird. Die Beziehung zwischen Sozialraum und Sozialer Arbeit ist ein zentrales Thema.
Welche Theorien werden im Text verglichen?
Der Text vergleicht konstruktivistische und materialistische Raumtheorien und plädiert für einen integrativen Ansatz, der beide Perspektiven vereint. Die verschiedenen Perspektiven auf den Raumbegriff werden im Kontext der Sozialwissenschaften und Sozialen Arbeit diskutiert.
Welche Kapitel beinhaltet der Text und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 befasst sich mit dem allgemeinen Raumbegriff und seiner Bedeutung in den Sozialwissenschaften, unterscheidet zwischen absolutem und relativem Raum und legt den Grundstein für die spätere Betrachtung des Sozialraumes. Kapitel 2 fokussiert auf den Zusammenhang zwischen Sozialraum und Sozialer Arbeit, erläutert die Sozialraumorientierung und analysiert die Konstruktion des Sozialraums durch menschliches Handeln.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Raum, Sozialraum, Sozialraumorientierung, absolute Raumvorstellung, relative Raumvorstellung, Soziale Arbeit, Konstruktivismus, Materialismus, Raumordnung, soziale Praxis.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist aufgrund seines akademischen Ansatzes und der detaillierten Auseinandersetzung mit raumtheoretischen Konzepten primär für Studierende und Wissenschaftler*innen im Bereich der Sozialwissenschaften und Sozialen Arbeit bestimmt.
- Arbeit zitieren
- Helene Erwin (Autor:in), 2008, (Sozial)Raum - ein Bestimmungsversuch, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/118628