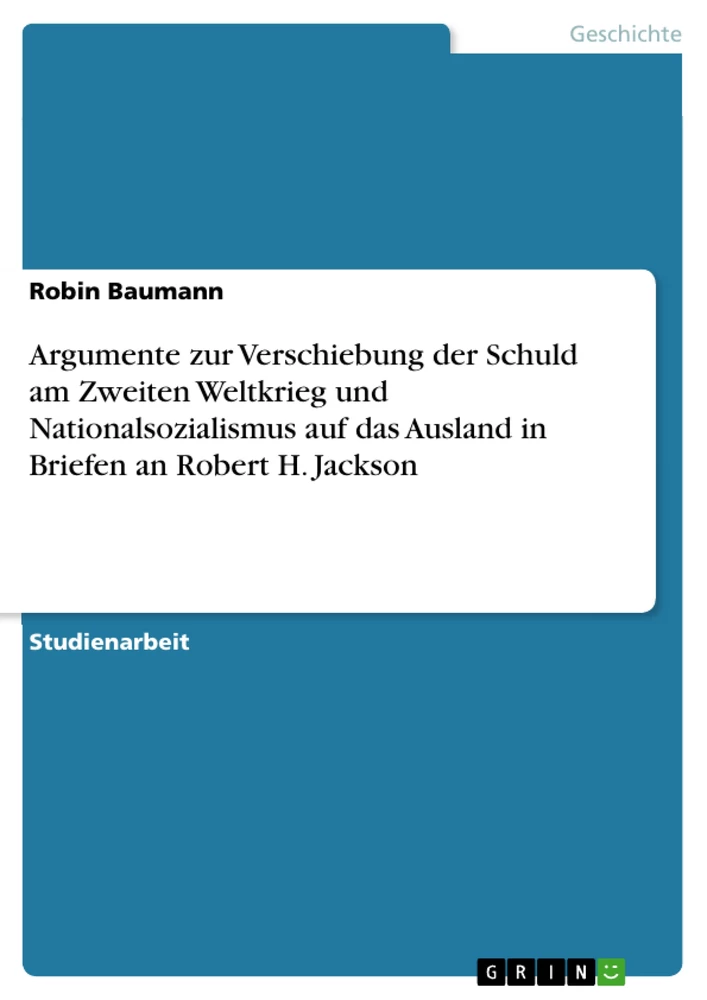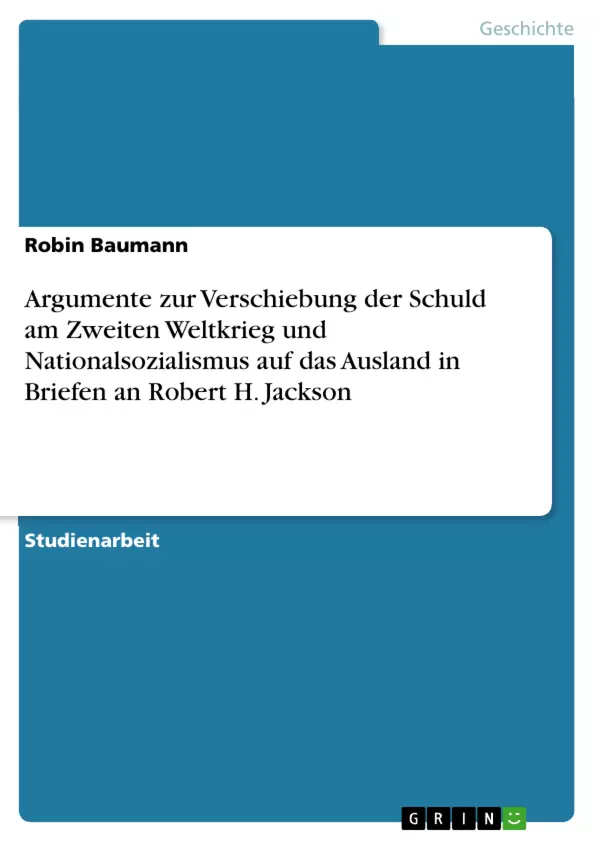In der vorliegenden Hausarbeit soll untersucht werden, auf welche Weise die Schuldexternalisierung erfolgte. Das geschieht anhand ausgewählter Briefe, welche Robert H. Jackson, der amerikanische Hauptankläger im Nürnberger Prozess, in den Jahren 1945 und 1946 von Deutschen erhalten hat. Aus der Sammlung der Briefe wurden jene 15 ausgewählt, in denen externalisierende Schulderklärungen zu finden sind. Die Briefe werden auf wiederkehrende Argumente hin untersucht, welche sich auch in den Kapiteln dieser Arbeit wiederfinden. Nach einer einführenden Vorstellung der Kriegsschulddiskussion folgt im zweiten Kapitel ein Überblick über die öffentliche Diskussion der Nürnberger Prozesse in Hinblick auf die Schuldfrage. Im zentralen Teil der Arbeit werden die Argumente der Briefe analysiert: Drei Schulderklärungen betreffen die Alliierten: Ihre Handlungen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, ihre Duldung Hitlers in den 1930ern, sowie ihre angeblich aggressive Außenpolitik am Ende der 1930er. Ein weiteres Kapitel widmet sich antisemitischen Kriegsschulderklärungen, die oftmals mit dem Ausland verknüpft werden. Ein Fazit beschließt die Arbeit.
Die zwölf Jahre der nationalsozialistischen Prägung, der Schock der Niederlage, aber besonders auch individuelles persönliches Leiden durch Zerstörung, Flucht oder Verlust verhinderten ein gemeinsames Schuldbewusstsein in der deutschen Gesellschaft. Eine Debatte um die Frage nach der Schuld am Nationalsozialismus und am Grauen des Zweiten Weltkrieges prägte die Öffentlichkeit. Weit verbreitet war ein Bedürfnis, all die Verbrechen der letzten Jahre zu erklären, ohne die Schuld des deutschen Volkes zu überhöhen oder anerkennen zu wollen. Dieses Bedürfnis konnte durch unterschiedliche Mechanismen erfüllt werden: Ein Großteil der Bevölkerung konzentrierte sich auf das eigene Unglück und nahm eine schuldentlastende Opferrolle an. Sie seien Opfer der böswilligen Nazis oder des dämonischen Hitlers gewesen, die das Volk verraten oder verführt hätten. Neben dieser Erklärung bot sich auch folgende an: Die eigentliche Ursache des Nationalsozialismus und damit möglicherweise die Schuld an ihm seien nicht primär in Deutschland zu suchen. Stattdessen wird vorgeschlagen, dass sie bei anderen Staaten zu finden sei, vor allem bei der USA, Großbritannien und der Sowjetunion. Auch das sog. ‚Weltjudentum‘ wird häufig beschuldigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundzüge der Kriegsschulddebatte in der unmittelbaren Nachkriegszeit
- 2. Die Schuldfrage in der öffentlichen Wahrnehmung des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses
- 3. Schuldverlagerung in Briefen an den Hauptanklagevertreter Jackson
- 3.1. Schuld ist Versailles. Politisches Verhalten der Siegermächte nach 1918.
- 3.2. Schuld sind die, die Hitler duldeten. Passivität der Westmächte in den 1930ern.
- 3.3. Schuld sind die aggressiven Großmächte. „Einkreisungspolitik“ und angebliche alliierte Kriegstreiberei in den späten 1930ern.
- 3.4. Schuld sind die Juden. Die jüdische Kriegsverschwörung und weitere antisemitische Schuldverlagerungen.
- 4. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Schuldverlagerung in Briefen an den amerikanischen Hauptankläger Robert H. Jackson im Nürnberger Prozess, die im Kontext der Kriegsschulddebatte in der unmittelbaren Nachkriegszeit steht. Sie beleuchtet die Mechanismen der Schuldexternalisierung und analysiert die Argumente, die von Deutschen im Nachkriegsdeutschland verwendet wurden, um die Schuld am Nationalsozialismus und am Zweiten Weltkrieg auf andere Staaten, insbesondere die USA, Großbritannien und die Sowjetunion, sowie auf das "Weltjudentum" zu schieben.
- Die Kriegsschulddebatte in der unmittelbaren Nachkriegszeit
- Die öffentliche Wahrnehmung des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses in Hinblick auf die Schuldfrage
- Die verschiedenen Argumente der Schuldverlagerung in Briefen an Robert H. Jackson
- Die Rolle der Alliierten im Kontext der Schuldverlagerung
- Antisemitische Kriegsschulderklärungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Schuldverlagerung in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein und beschreibt das Bedürfnis der deutschen Gesellschaft, die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erklären, ohne die eigene Schuld zu übernehmen. Sie stellt den Kontext der Hausarbeit dar und beschreibt die ausgewählten Briefe, die als Quellenmaterial dienen.
Kapitel 1 beleuchtet die Grundzüge der Kriegsschulddebatte in der unmittelbaren Nachkriegszeit und zeigt auf, wie verschiedene Opfergruppen parallelisiert wurden, um die Schuld am Leid des deutschen Volkes zu relativieren. Der Begriff der Kollektivschuld wird diskutiert und die Ablehnung dieser These durch einen Großteil der deutschen Bevölkerung wird erläutert.
Kapitel 2 geht auf die öffentliche Wahrnehmung des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses in Hinblick auf die Schuldfrage ein. Es wird beleuchtet, wie die Schuldfrage in der deutschen Gesellschaft diskutiert wurde und welche Mechanismen zur Vermeidung der Schuldübernahme eingesetzt wurden.
Kapitel 3 analysiert die verschiedenen Argumente der Schuldverlagerung, die in den Briefen an Robert H. Jackson zum Ausdruck kommen. Es werden die Schuldzuweisungen an die Alliierten für ihre Handlungen nach dem Ersten Weltkrieg, ihre Duldung Hitlers in den 1930er Jahren und ihre angeblich aggressive Außenpolitik am Ende der 1930er Jahre untersucht.
Kapitel 3.4 widmet sich antisemitischen Kriegsschulderklärungen, die in den Briefen an Robert H. Jackson vorkommen. Es wird gezeigt, wie die Schuld am Zweiten Weltkrieg auf die Juden geschoben wird und welche antisemitischen Argumente in diesem Kontext verwendet werden.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Schuldverlagerung, der Kriegsschulddebatte, der öffentlichen Wahrnehmung des Nürnberger Prozesses, den Argumenten der Schuldverlagerung, der Rolle der Alliierten, antisemitischen Kriegsschulderklärungen und der deutschen Gesellschaft im Kontext der unmittelbaren Nachkriegszeit. Weitere wichtige Begriffe sind: Kollektivschuld, Opferdiskurs, Schuldexternalisierung, Täter-Opfer-Umkehr, Versailles, „Einkreisungspolitik“, jüdische Kriegsverschwörung, und die Briefe an Robert H. Jackson.
- Quote paper
- Robin Baumann (Author), 2021, Argumente zur Verschiebung der Schuld am Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus auf das Ausland in Briefen an Robert H. Jackson, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1185136