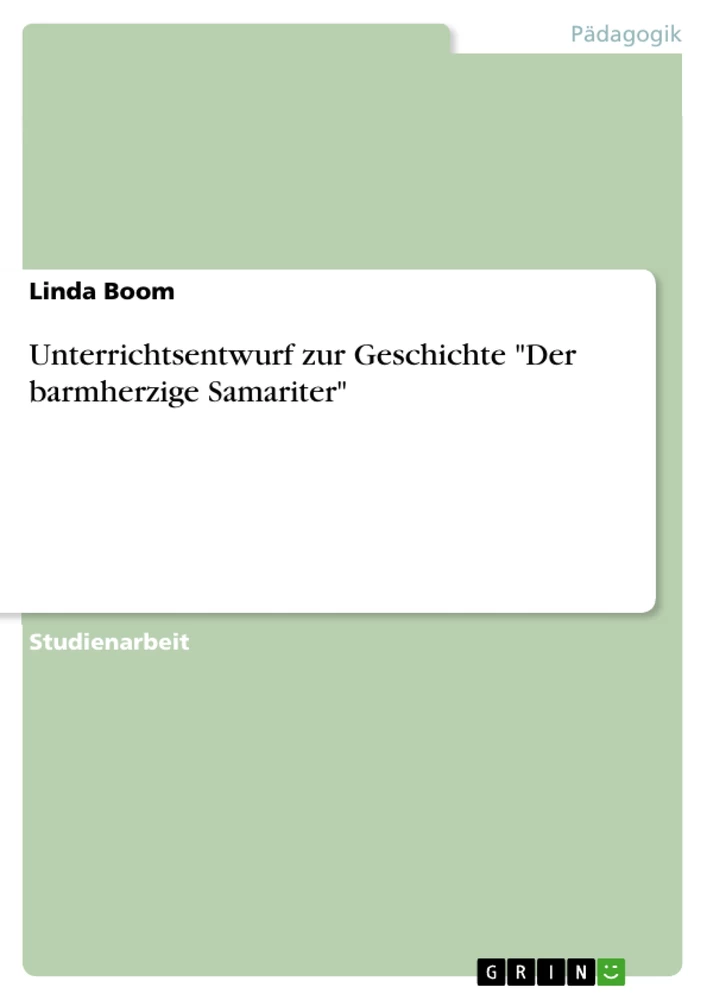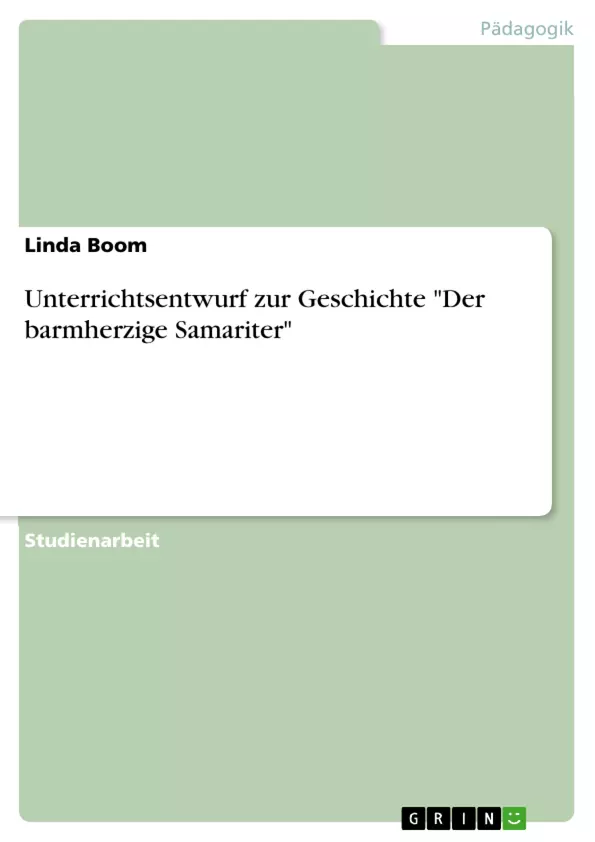In der nachfolgenden Analyse wird die vorliegende Perikope näher betrachtet. Dazu werde ich zunächst den Aufbau kurz darstellen, um weiterführend Begriffe zu erläutern, die der religionsgeschichtlichen Analyse angehören. Abschließend wird ein Bezug zur heutigen Zeit gefunden.
Die Erzählung von dem barmherzigen Samariter steht im zehnten Kapitel des Lukasevangeliums und somit verhältnismäßig am Anfang des, aus insgesamt 24 Kapitel bestehenden, Lukasevangeliums. Das Lukasevangelium beginnt, anders als die anderen Evangelien des Neuen Testaments, mit einem Vorwort (Lk 1, 1-4), welches die Absicht des Werkes sichtbar macht. Das Lukasevangelium lässt sich in vier weitere Teile eingliedern. Zu Beginn des Evangeliums wird die Vorgeschichte vom Leben Jesu Christi und dessen Geburt sowie das Auftreten und das Wirken des Täufers beschrieben. (Lk 1,5 - 4,44). Das (missionarische) Wirken Jesu wird im zweiten Teil, welcher sich von Lk 5,1 bis Lk 9,50 erstreckt, behandelt. Dieser Teil ist von Wundergeschichten und Heilungen der Kranken geprägt. Im dritten Teil wird Jesu Lehre auf dem Weg (Lk 9,51 - 19,10) beschrieben. Dieser Teil nimmt den größten Teil des Lukasevangeliums und somit eine elementare Stellung des Evangeliums ein. Hier nutzt Lukas ausschließlich Überlieferungen und Sondergut.
Auch die vorliegende Perikope steht in diesem Teil geschrieben. Im letzten Teil des Evangeliums nach Lukas wird die Vollendung der Welt und die Verherrlichung Jesu beschrieben (Lk 19,11 - 24,53). Bestandteile sind somit die Passionsgeschichte und die Auferstehung Jesu. Das Evangelium endet mit der Entrückung in den Himmel. Weiterführend wird die vorliegende Bibelstelle näher betrachtet und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Bibelstelle
- 2. Sachanalyse
- 3. Bedingungsanalyse
- 4. Tabelle der Unterrichtsstunde – didaktische Analyse
- 5. Methodische Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, die Geschichte des barmherzigen Samariters (Lk 10, 25-37) didaktisch aufzuarbeiten und für den Schulunterricht nutzbar zu machen. Der Entwurf analysiert die Bibelstelle, ihren Kontext und ihre Relevanz für die heutige Zeit. Die methodische Umsetzung im Unterricht wird ebenfalls detailliert betrachtet.
- Die Bedeutung der Nächstenliebe
- Interpretation des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter
- Der Kontext der Perikope im Lukasevangelium
- Die Anwendung des Gleichnisses auf den Schulalltag
- Die Rolle von Handlung und Taten in Bezug auf Nächstenliebe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Bibelstelle: Die Bibelstelle präsentiert den Dialog zwischen Jesus und einem Gesetzeslehrer über das ewige Leben. Der Gesetzeslehrer zitiert das Gebot der Nächstenliebe, woraufhin Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, um die Frage nach dem "Nächsten" zu veranschaulichen. Das Gleichnis schildert einen Überfallenen, an dem Priester und Levit vorbeigehen, während ein Samariter ihm hilft. Jesus betont somit die Handlung der Barmherzigkeit als essentiellen Aspekt der Nächstenliebe.
2. Sachanalyse: Dieser Abschnitt analysiert die Perikope des barmherzigen Samariters im Kontext des Lukasevangeliums. Er beschreibt den Aufbau des Evangeliums und positioniert die Perikope innerhalb der Erzählstruktur. Die Analyse beleuchtet den Dialog zwischen Jesus und dem Gesetzeslehrer, interpretiert die verschiedenen Akteure (Priester, Levit, Samariter) und betont die Bedeutung der Nächstenliebe als zentrales Thema. Die Relevanz des Gleichnisses für die heutige Zeit wird hervorgehoben, indem die Anwendung der Nächstenliebe im Schulalltag diskutiert wird.
Schlüsselwörter
Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gleichnis des barmherzigen Samariters, Lukasevangelium, religionsgeschichtliche Analyse, didaktische Umsetzung, Schulalltag, Handlung, Tat.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf: Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter
Was beinhaltet dieser Unterrichtsentwurf?
Dieser umfassende Unterrichtsentwurf behandelt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 25-37). Er umfasst eine detaillierte Bibelstellenanalyse, eine Sachanalyse des Kontextes im Lukasevangelium, eine methodische Analyse für den Unterricht, die didaktische Aufbereitung und die Zielsetzung sowie Schlüsselbegriffe und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel.
Welche Kapitel umfasst der Entwurf?
Der Entwurf gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Bibelstelle; 2. Sachanalyse; 3. Bedingungsanalyse; 4. Tabelle der Unterrichtsstunde – didaktische Analyse; 5. Methodische Analyse.
Was ist die Zielsetzung des Unterrichtsentwurfs?
Der Entwurf zielt darauf ab, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter didaktisch aufzuarbeiten und für den Schulunterricht nutzbar zu machen. Es soll die Bedeutung der Nächstenliebe im Kontext des Gleichnisses und seine Relevanz für die heutige Zeit verdeutlicht werden. Die methodische Umsetzung im Unterricht wird detailliert beschrieben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Bedeutung der Nächstenliebe, die Interpretation des Gleichnisses, der Kontext der Perikope im Lukasevangelium, die Anwendung des Gleichnisses auf den Schulalltag und die Rolle von Handlung und Taten in Bezug auf Nächstenliebe.
Wie wird die Bibelstelle im Entwurf behandelt?
Das Kapitel "Bibelstelle" präsentiert den Dialog zwischen Jesus und einem Gesetzeslehrer und die anschließende Erzählung des Gleichnisses. Der Fokus liegt auf der Veranschaulichung der Frage nach dem "Nächsten" und der Bedeutung der Barmherzigkeit als essentieller Aspekt der Nächstenliebe.
Was beinhaltet die Sachanalyse?
Die Sachanalyse betrachtet die Perikope im Kontext des Lukasevangeliums. Sie beschreibt den Aufbau des Evangeliums, die Positionierung der Perikope, den Dialog zwischen Jesus und dem Gesetzeslehrer, interpretiert die Akteure (Priester, Levit, Samariter) und betont die zentrale Bedeutung der Nächstenliebe. Die Relevanz für den heutigen Schulalltag wird diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gleichnis des barmherzigen Samariters, Lukasevangelium, religionsgeschichtliche Analyse, didaktische Umsetzung, Schulalltag, Handlung, Tat.
- Quote paper
- Linda Boom (Author), 2022, Unterrichtsentwurf zur Geschichte "Der barmherzige Samariter", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1183662