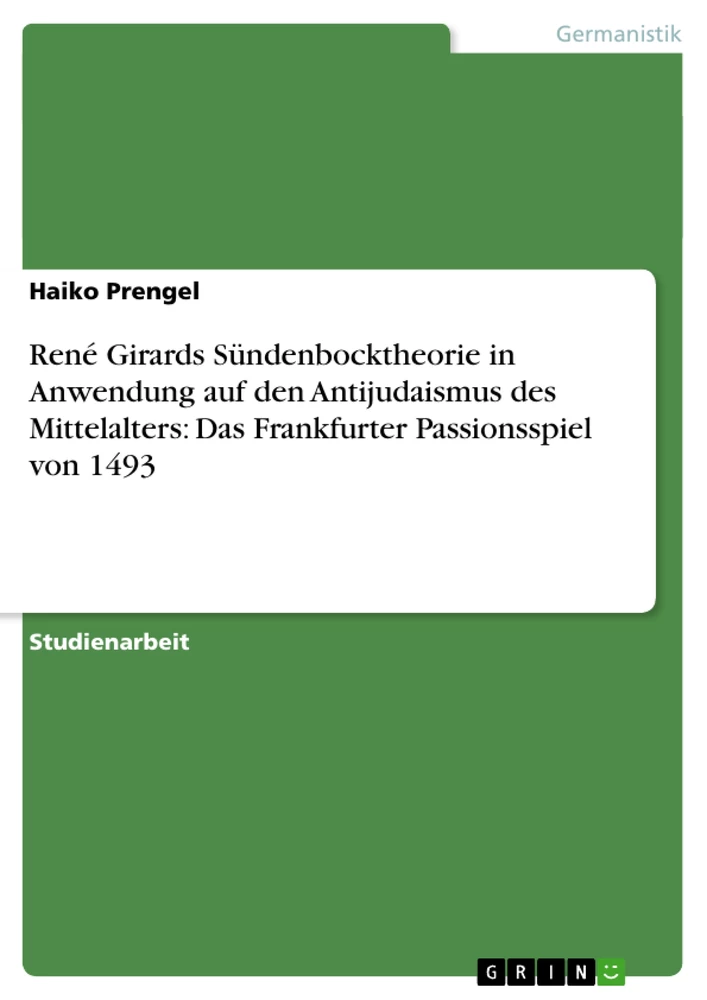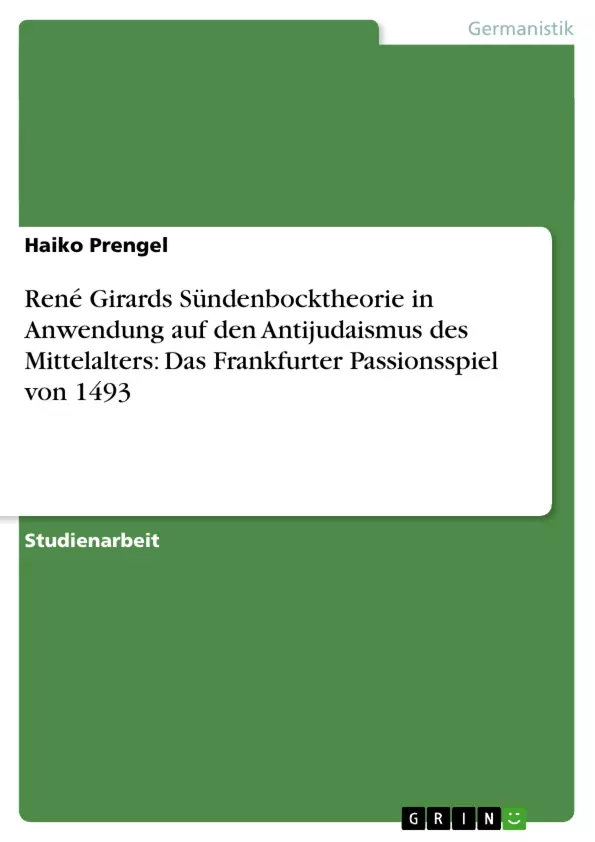Bei vielen Untersuchungen von Judenfeindschaft im Mittelalter drängt sich gewohnheitsgemäß die Frage auf, ob jener Antijudaismus mit dem modernen Antisemitismus seit dem 19. und vor allem dem des 20. Jahrhunderts vergleichbar ist. Ohne Zweifel ist diese Frage mit Nein zu beantworten; doch wäre der Antisemitismus ohne den Jahrhunderte lang währenden Antijudaismus des Mittelalters und der späten Antike nicht denkbar gewesen.
Die rassistische Komponente des Antisemitismus spielte im Mittelalter keine Rolle. Allerdings kann man eine kontinuierliche Erweiterung der Anschuldigungsmotive und Opferstereotype feststellen.
Das geistliche Spiel, als Oster-, Weihnachts- oder Passionsspiel auf den städtischen und dörflichen Bühnen dramatisch vorgetragen, war im Hoch- und Spätmittelalter nicht nur eine beliebte Art, die ewige Auseinandersetzung um die Auslegung der Evangelien weiterzuführen. Vielmehr bot die künstlerische Plattform mit teils Hunderten von Schauspielern und Statisten auf spektakuläre Weise auch die Möglichkeit, im Namen der Kirche öffentlich gegen Juden zu hetzen.
Die Tatsache, dass diese Form des mittelalterlichen Dramas über mehrere Jahrhunderte aufgeführt wurde und die Passionsspieltexte samt Regieanweisungen bis heute erhalten sind, ermöglicht eine gründliche Rekonstruktion der damaligen Ereignisse.
Anhand der Kontinuität der Judenverfolgung vor dem Hintergrund der christlichen Passionsspiele als historische Station soll die Theorie vom Sündenbock, die René Girard Ende des vergangenen Jahrhunderts entwickelte, untersucht werden. Universale Aspekte der Sündenbocktheorie werden auf die Passionsspiele (v.a. auf das Frankfurter Passionsspiel von 1493) angewendet und analysiert. Die zentrale Fragestellung wird demnach sein, ob Girards Theorie so universal ist, dass sie auf die antijudaistischen Passionsspiele des Mittelalters angewendet werden kann.
Zunächst wird Girards Theorie in ihren wichtigsten Punkten vorgestellt, werden die Stereotypen der Verfolgung erläutert. Nach der Untersuchung der Passionsspiele auf die Anwendbarkeit der Girardschen Theorie möchte die Arbeit klären, ob nicht jede Epoche seine eigenen Stereotypen der Verfolgung hervorbringt oder ob tatsächlich eine temporär wie geografisch stereotype Universaldynamik bei der Findung von Sündenböcken existiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Girards Sündenbocktheorie: Die Stereotypen der Verfolgung
- Das Stereotyp der Krise
- Das Stereotyp der Anschuldigungen
- Das Stereotyp der Opferselektion
- Das Stereotyp der Gewalt selbst
- Das Frankfurter Passionsspiel von 1493: Einleitung
- Die Anschuldigungsmotive gegen die Juden im Frankfurter Passionsspiel
- Die theologischen Motive Verstocktheit, Blindheit und Teufelsbund
- Die ökonomischen Motive Habgier, Zinshandel und Wucher
- Die psychopathologischen Motive Spott, Sadismus und Gottesmord
- Die Anschuldigungsmotive gegen die Juden im Frankfurter Passionsspiel
- Immer die gleichen Anschuldigungen?
- Fazit
- Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit von René Girards Sündenbocktheorie auf den Antijudaismus des Mittelalters, speziell anhand des Frankfurter Passionsspiels von 1493. Ziel ist es, die Universalität von Girards Theorie zu überprüfen und zu analysieren, ob die im Mittelalter vorgefundenen Stereotypen der Judenverfolgung mit den von Girard beschriebenen übereinstimmen.
- Anwendbarkeit der Sündenbocktheorie auf den mittelalterlichen Antijudaismus
- Analyse der Stereotypen der Verfolgung im Frankfurter Passionsspiel von 1493
- Vergleich der Stereotypen mit Girards Theorie
- Untersuchung der Kontinuität der Anschuldigungsmotive gegen Juden
- Bewertung der Universalität der Sündenbockdynamik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Vergleichbarkeit des mittelalterlichen Antijudaismus mit dem modernen Antisemitismus. Sie verneint eine direkte Gleichsetzung, betont aber die historische Kontinuität und die Bedeutung der Passionsspiele als öffentliche Plattform antijüdischer Hetze. Die Arbeit kündigt die Anwendung von Girards Sündenbocktheorie auf das Frankfurter Passionsspiel von 1493 an, um die Universalität dieser Theorie zu untersuchen und die Frage nach der Existenz einer zeitlich und geografisch konstanten Stereotypendynamik bei der Sündenbockfindung zu klären.
Girards Sündenbocktheorie: Die Stereotypen der Verfolgung: Dieses Kapitel präsentiert die wichtigsten Punkte von Girards Sündenbocktheorie. Es betont die Unterscheidung zwischen individueller und kollektiver Verfolgung, wobei sich die Arbeit auf letztere konzentriert. Die Theorie postuliert die Universalität der Sündenbockmechanismen und beschreibt vier wiederkehrende Stereotypen: das Stereotyp der Krise, das Stereotyp der Anschuldigung, das Stereotyp der Opferselektion und das Stereotyp der Gewalt selbst. Das Kapitel legt den Fokus auf kollektive Verfolgungen, die eine größere Masse betreffen, und betont die Universalität der Theorie in Bezug auf Opfer und Stereotypen.
Das Frankfurter Passionsspiel von 1493: Einleitung: Dieser Abschnitt dient als Einführung in das Frankfurter Passionsspiel von 1493 und seine Relevanz für die Untersuchung des mittelalterlichen Antijudaismus. Er legt die Grundlage für die anschließende detaillierte Analyse der Anschuldigungsmotive gegen die Juden im Spiel.
Schlüsselwörter
René Girard, Sündenbocktheorie, Antijudaismus, Mittelalter, Frankfurter Passionsspiel 1493, Stereotypen der Verfolgung, Kollektive Gewalt, Anschuldigungsmotive, Theologische Motive, Ökonomische Motive, Psychopathologische Motive, Judenverfolgung, Kontinuität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Frankfurter Passionsspiel von 1493 und René Girards Sündenbocktheorie
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit von René Girards Sündenbocktheorie auf den mittelalterlichen Antijudaismus, speziell anhand des Frankfurter Passionsspiels von 1493. Sie analysiert, ob die im Mittelalter vorgefundenen Stereotypen der Judenverfolgung mit den von Girard beschriebenen übereinstimmen und bewertet die Universalität der Sündenbockdynamik.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Universalität von Girards Theorie zu überprüfen und die Kontinuität der Anschuldigungsmotive gegen Juden zu untersuchen. Konkret werden die Stereotypen der Verfolgung im Frankfurter Passionsspiel von 1493 analysiert und mit Girards Theorie verglichen. Die Anwendbarkeit der Sündenbocktheorie auf den mittelalterlichen Antijudaismus steht im Mittelpunkt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, Girards Sündenbocktheorie mit ihren Stereotypen der Verfolgung (Krise, Anschuldigung, Opferselektion, Gewalt), einer Einleitung zum Frankfurter Passionsspiel von 1493, einer Analyse der Anschuldigungsmotive im Passionsspiel (theologische, ökonomische, psychopathologische Motive), einer Betrachtung der Kontinuität der Anschuldigungen, einem Fazit und den Quellenangaben.
Wie werden die Anschuldigungsmotive im Frankfurter Passionsspiel von 1493 kategorisiert?
Die Anschuldigungsmotive gegen die Juden im Frankfurter Passionsspiel werden in drei Kategorien eingeteilt: theologische Motive (Verstocktheit, Blindheit, Teufelsbund), ökonomische Motive (Habgier, Zinshandel, Wucher) und psychopathologische Motive (Spott, Sadismus, Gottesmord).
Welche Rolle spielt René Girards Sündenbocktheorie?
Girards Sündenbocktheorie dient als analytisches Werkzeug, um die Stereotypen der Judenverfolgung im Frankfurter Passionsspiel zu untersuchen und die Universalität der Sündenbockmechanismen zu überprüfen. Die Theorie beschreibt wiederkehrende Stereotypen in Verfolgungsprozessen, die auf ihre Anwendung im mittelalterlichen Kontext geprüft werden.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Der HTML-Auszug enthält kein explizites Fazit. Die Schlussfolgerung muss aus der Analyse der Kapitelzusammenfassungen erschlossen werden. Die Arbeit prüft die Anwendbarkeit der Theorie auf den mittelalterlichen Antijudaismus und die Kontinuität der Anschuldigungsmotive.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: René Girard, Sündenbocktheorie, Antijudaismus, Mittelalter, Frankfurter Passionsspiel 1493, Stereotypen der Verfolgung, Kollektive Gewalt, Anschuldigungsmotive, Theologische Motive, Ökonomische Motive, Psychopathologische Motive, Judenverfolgung, Kontinuität.
- Quote paper
- Magister Artium Haiko Prengel (Author), 2002, René Girards Sündenbocktheorie in Anwendung auf den Antijudaismus des Mittelalters: Das Frankfurter Passionsspiel von 1493, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/11816