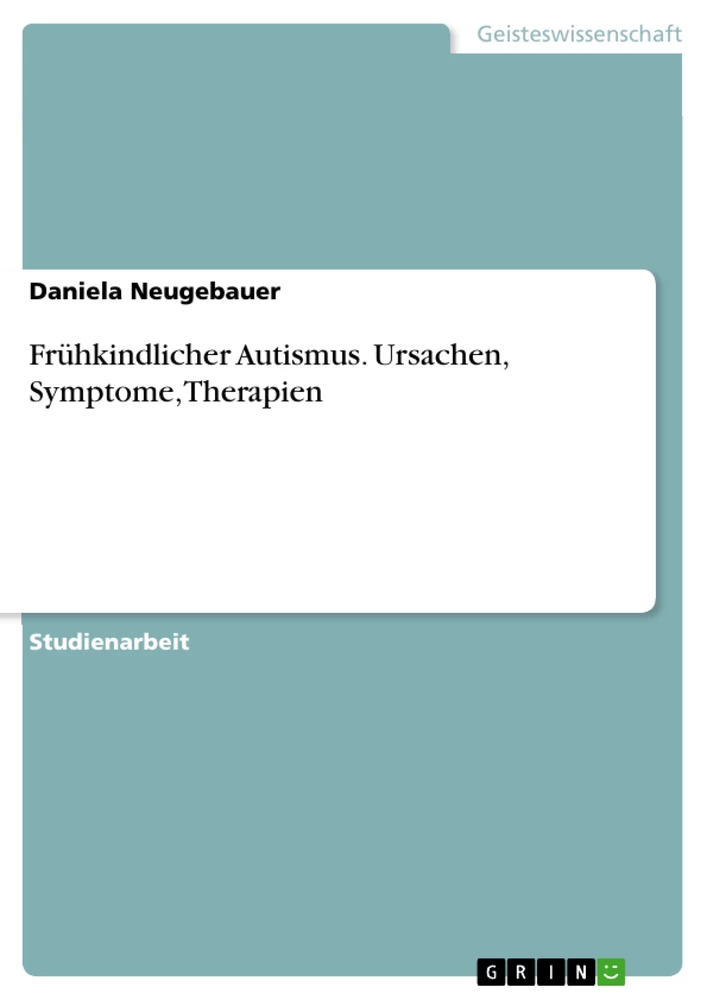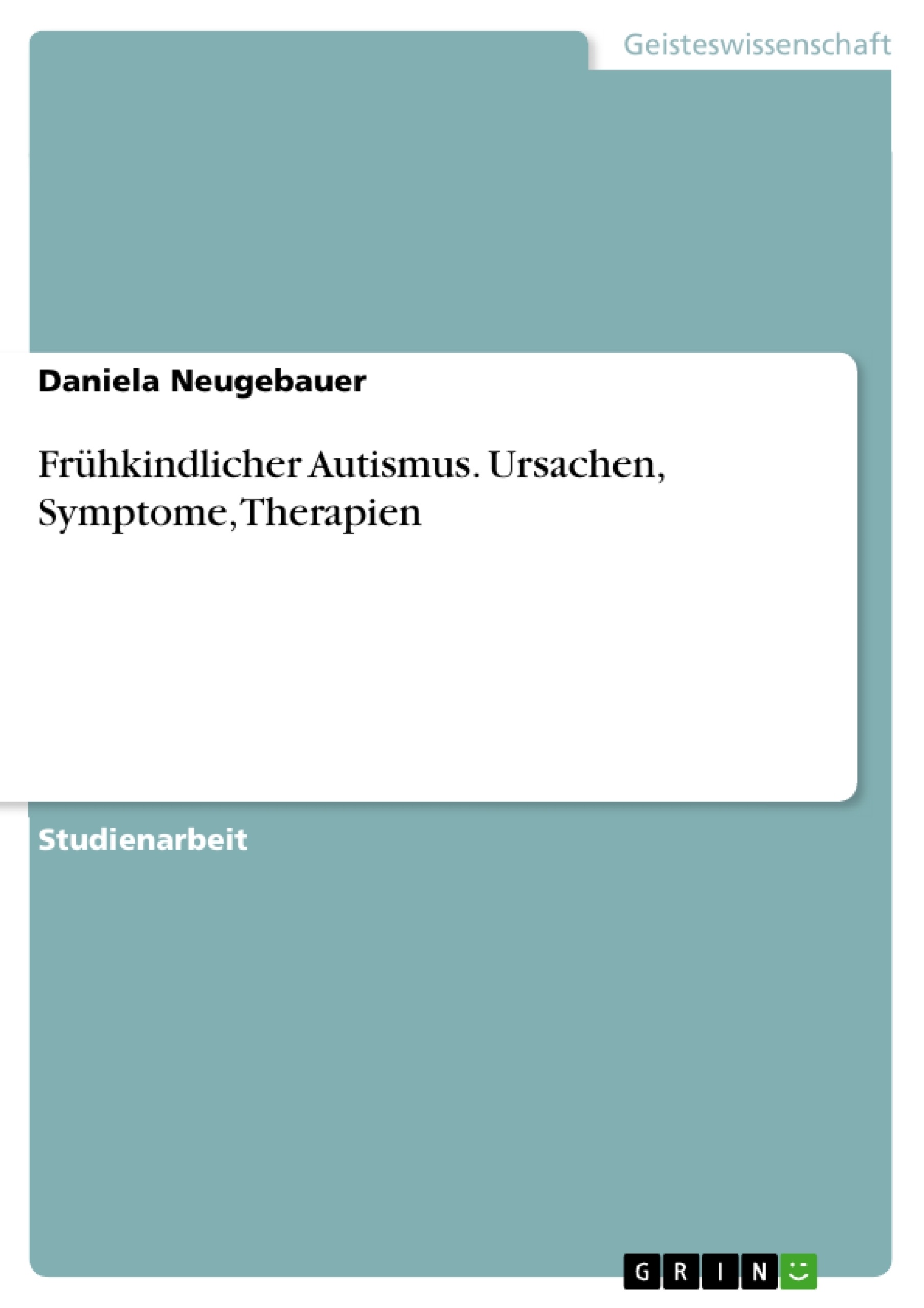Autismus ist eine schwere Behinderung, die sich überwiegend durch ein Defizit in der Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit und folglich fehlender sozialer Interaktion auszeichnet. Es ist nicht ersichtlich, wodurch diese schwere und unheilbare Behinderung ausgelöst wird. Da Autismus bereits in den ersten drei Lebensjahren auftritt, aber häufig erst viel später diagnostiziert wird, möchte ich mich in dieser Arbeit hauptsächlich mit dem frühkindlichen Autismus auseinandersetzen.
Zunächst möchte ich den Begriff „Autismus“ verständlich machen. Anschließend werde ich mich auf den frühkindlichen Autismus beziehen und danach einen kurzen Vergleich mit anderen Entwicklungsstörungen ziehen. Nach der Definition gebe ich einen Überblick über den geschichtlichen Hintergrund. Weiterhin möchte ich über Ursachen und Symptome aufklären und dabei verdeutlichen, wie schwerwiegend diese Behinderung in Wirklichkeit sein kann. Außerdem werde ich einen Teil der zahlreichen Therapien veranschaulichen. Zum Schluss werde ich, anhand von Langzeitstudien, noch Zukunftsaussichten der Menschen, die an frühkindlichem Autismus leiden, veranschaulichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Hintergrund
- Epidemiologie
- Ursachen
- Die psychogenetische Ursache
- Genetische Faktoren
- Hirnschädigungen
- Biochemische Ursachen
- Begriffserläuterung
- Symptome
- Verhalten in den ersten beiden Lebensjahren
- Sprachstörungen
- Stereotypisches Verhalten
- Wahrnehmung
- Soziales Verhalten
- Motorisches Verhalten
- Diagnose
- Therapien
- Verhaltenstherapeutische Interventionen
- Biologisch orientierte Methoden
- Zukunft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für frühkindlichen Autismus zu entwickeln. Die Arbeit befasst sich mit dem geschichtlichen Hintergrund, der Definition, den Ursachen und Symptomen dieser Entwicklungsstörung. Darüber hinaus werden verschiedene Therapien beleuchtet und eine Zukunftsperspektive für Menschen mit frühkindlichem Autismus aufgezeigt.
- Geschichtlicher Hintergrund und Entwicklung des Begriffs „Autismus“
- Definition und Abgrenzung von verschiedenen Formen des Autismus
- Ursachen und Einflüsse auf die Entstehung von frühkindlichem Autismus
- Symptome und Auswirkungen von frühkindlichem Autismus auf die Entwicklung und das Leben Betroffener
- Therapiemöglichkeiten und ihre Wirksamkeit im Umgang mit frühkindlichem Autismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt eine Einführung in das Thema Autismus und beleuchtet die Geschichte des Begriffs. Es werden verschiedene Theorien und Ansätze zur Entstehung von Autismus vorgestellt. Das zweite Kapitel definiert den Begriff „Autismus“ und unterscheidet verschiedene Formen der Störung. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Symptomen von frühkindlichem Autismus, wobei verschiedene Verhaltensmuster und Auffälligkeiten im Detail beschrieben werden. Das vierte Kapitel beleuchtet verschiedene Therapieansätze, die bei frühkindlichem Autismus zum Einsatz kommen.
Schlüsselwörter
Frühkindlicher Autismus, Entwicklungsstörung, Kommunikation, Soziales Verhalten, Wahrnehmung, Sprache, Stereotypie, Therapie, Verhaltenstherapie, Biologische Therapie, Zukunftsperspektive, Geschichte, Definition, Ursachen, Symptome.
- Arbeit zitieren
- M. A. Daniela Neugebauer (Autor:in), 2012, Frühkindlicher Autismus. Ursachen, Symptome, Therapien, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1180622