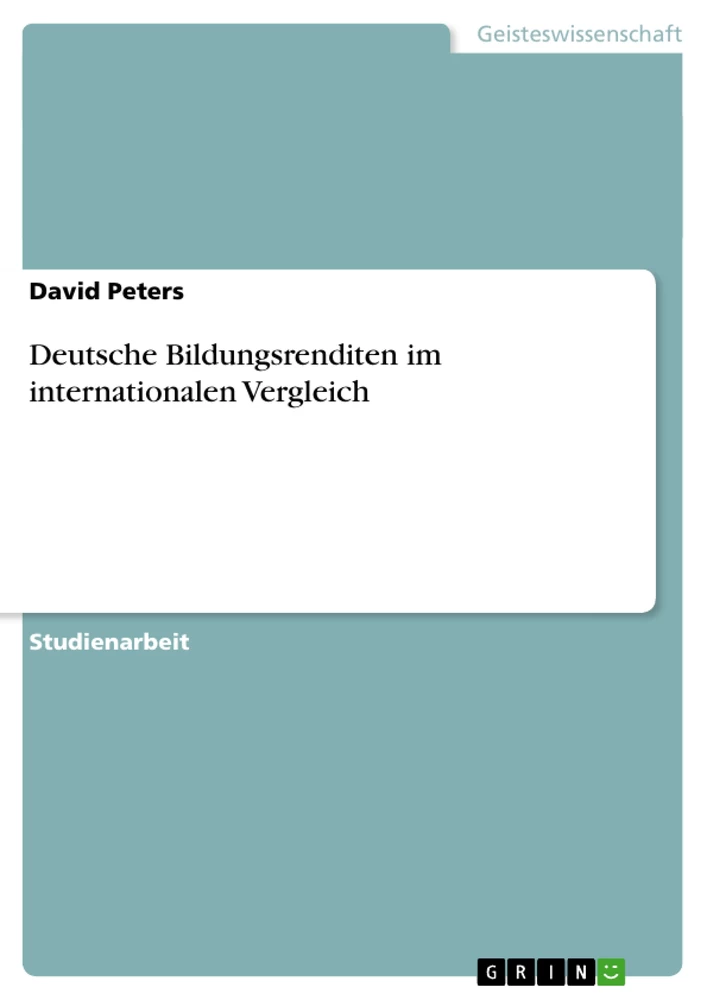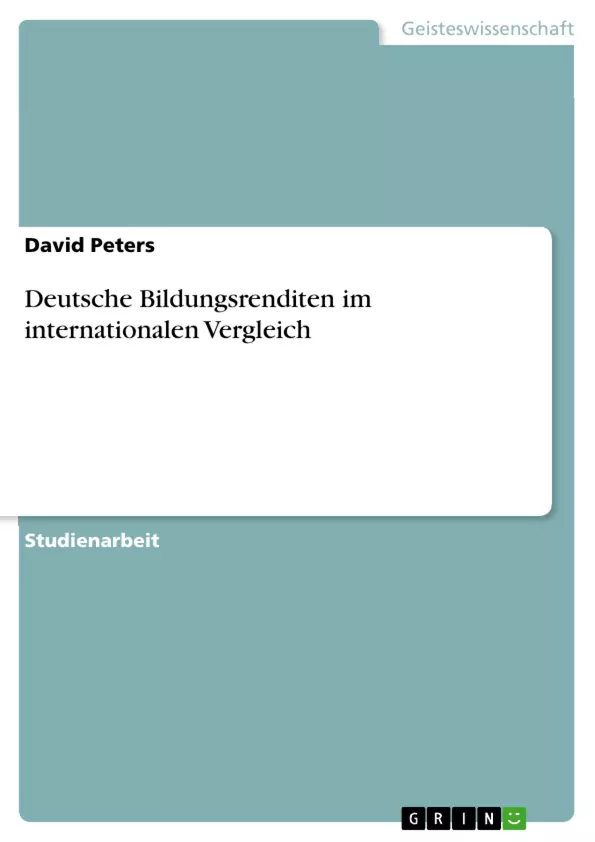Seit den Ergebnissen „der PISA-Studie der OECD“ (Ammermüller & Dohmen 2004: 7) wird
die Qualität von Bildung erneut kritisch betrachtet. Neben der qualitativen Sichtweise von
Bildung wird auch die „ökonomische Bedeutung von Bildung“ (Ammermüller & Dohmen
2004: 7) immer stärker diskutiert. Ausgangspunkt dieser Diskussion ist die Grundthese der
Humankapitaltheorie, wonach sich die Produktivität eines Arbeiters dann erhöht, wenn Investitionen
in das Humankapital z.B. durch Ausbildung vorgenommen werden (vgl. Sesselmeier
& Blauermel 1998: 66). Eine höhere Produktivität führt im Regelfall zu steigendem Einkommen,
was sowohl „für die Person“ (Ammermüller & Dohmen 2004: 8) selbst, aber auch für
die gesamte „Gesellschaft“ (Ammermüller & Dohmen 2004: 9) von Vorteil ist.
Mit dem Konzept der Bildungsrenditen wurde nun ein Konzept geschaffen, mit dem der ökonomische
Wert von Bildung geschätzt werden kann. Durch diese Schätzungen wird ein direkter
Vergleich von Investitionen und Erträgen ermöglicht. Aus diesem Vergleich kann dann
eine Entscheidung resultieren, ob sich eine weitere Schulausbildung für einen Akteur lohnt
oder ob ein Eintritt in die berufliche Ausbildung sinnvoller ist. Eine zweite Möglichkeit zur
Nutzung dieser Schätzung reicht bis hin zu einem internationalen Vergleich der Bildungserträge.
Durch die Berechnung von Bildungsrenditen in verschiedenen Ländern kann direkt
verglichen werden, in welchem Land höhere Erträge und in welchem Land geringere Erträge
bei gleicher Schulbildung zu erwarten sind. Besonders im Hinblick auf unsere „sich globalisierenden
Welt“ (Ammermüller & Dohmen 2004: 7) ist dies entscheidend wichtig, um dem
internationalen Wettbewerb standzuhalten.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Berechnung der Bildungsrenditen zu erläutern, kurz auf internationale
Bildungserträge einzugehen um dann schließlich die deutschen Bildungserträgen detaillierter
zu betrachten. Im folgenden zweiten Kapitel dieser Arbeit wird zunächst eine Methode
zur Schätzung von Bildungsrenditen dargestellt. Diese wurde von Becker (1964) und Mincer
(1974) auf Grundlage der Humankapitaltheorie entwickelt. Im dritten Kapitel wird dann mithilfe
einer Studie von Lorenz und Wagner (1993) zur Bildungsökonomie auf internationale
Bildungserträge eingegangen. Im vierten Kapitel werden deutsche Bildungserträge dargestellt,
die durch eine Analyse von Daten der allgemeinen Bevölkerungsumfrage (ALLBUS) berechnet
und diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Berechnung von Bildungsrenditen
- 2.1 Das Schooling Model
- 2.2 Post-School Investments
- 2.3 Probleme des Konzeptes
- 3. Bildungsrenditen im internationalen Vergleich
- 4. Bildungsrenditen in Deutschland
- 4.1 Praktische Berechnung der Bildungsrenditen
- 4.2 Analyse von ALLBUS-Daten
- 4.3 Diskussion
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Berechnung von Bildungsrenditen, beleuchtet internationale Vergleiche und analysiert detailliert die deutschen Bildungsrenditen. Die Arbeit erläutert zunächst ein methodisches Vorgehen zur Schätzung von Bildungsrenditen basierend auf der Humankapitaltheorie. Anschließend werden internationale Bildungserträge im Kontext einer bestehenden Studie betrachtet. Der Fokus liegt schließlich auf der Darstellung und Diskussion deutscher Bildungserträge, berechnet anhand von ALLBUS-Daten.
- Berechnung von Bildungsrenditen nach Mincer und Becker
- Internationaler Vergleich von Bildungserträgen
- Analyse deutscher Bildungserträge anhand von ALLBUS-Daten
- Anwendung der Humankapitaltheorie auf Bildungsrenditen
- Probleme und Grenzen des bildungsökonomischen Konzeptes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bildungsrenditen ein und begründet deren Bedeutung im Kontext der PISA-Studie und der zunehmenden Diskussion um die ökonomische Bedeutung von Bildung. Sie stellt die Grundthese der Humankapitaltheorie vor und erklärt, wie Bildungsrenditen den ökonomischen Wert von Bildung messen und internationale Vergleiche ermöglichen. Die Arbeit skizziert die Zielsetzung, die darin besteht, die Berechnung von Bildungsrenditen zu erläutern, internationale Bildungserträge zu betrachten und sich detailliert mit deutschen Bildungserträgen auseinanderzusetzen. Der Aufbau der Arbeit mit ihren einzelnen Kapiteln wird prägnant umrissen.
2. Die Berechnung von Bildungsrenditen: Dieses Kapitel präsentiert das Mincer-Becker-Modell zur Berechnung von Bildungsrenditen, beginnend mit dem „Schooling Model“, das die Grundannahme der Humankapitaltheorie mathematisch darstellt. Es erweitert dieses Modell um „Post-School Investments“ wie berufsbezogene Weiterbildungen und diskutiert abschließend die Probleme und Grenzen des Konzeptes, einschließlich der Aussagekraft der Berechnungen. Das Kapitel fokussiert auf die mathematische Modellierung des Zusammenhangs zwischen Schulbildung, Einkommen und der Rendite von Bildungsinvestitionen, wobei die Limitationen der Modellierung kritisch hinterfragt werden.
3. Bildungsrenditen im internationalen Vergleich: Dieses Kapitel (basierend auf Lorenz und Wagner 1993) befasst sich mit einem internationalen Vergleich von Bildungserträgen. Es analysiert, wie sich Bildungsinvestitionen in verschiedenen Ländern auf das Einkommen auswirken und welche Unterschiede in den Renditen bestehen. Das Kapitel wird die Ergebnisse der Studie diskutieren, möglicherweise unterschiedliche nationale Bildungssysteme und ihre Auswirkungen auf die Bildungsrenditen beleuchten und die Bedeutung von internationalen Vergleichen im Kontext der Globalisierung hervorheben.
4. Bildungsrenditen in Deutschland: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse deutscher Bildungserträge, die auf Basis von ALLBUS-Daten berechnet werden. Es beschreibt die praktische Berechnung der Renditen, präsentiert die Ergebnisse der ALLBUS-Datenanalyse und diskutiert diese Ergebnisse kritisch. Hier wird der Fokus auf die spezifischen sozioökonomischen Faktoren liegen, die die Bildungsrenditen in Deutschland beeinflussen. Das Kapitel wird wahrscheinlich eine detaillierte Interpretation der Daten und ihrer Implikationen für die deutsche Bildungslandschaft liefern.
Schlüsselwörter
Bildungsrenditen, Humankapitaltheorie, Schooling Model, Post-School Investments, Mincer-Becker-Modell, ALLBUS-Daten, internationale Vergleiche, Bildungsökonomie, ökonomischer Wert von Bildung, Produktivität, Einkommen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Berechnung und Analyse von Bildungsrenditen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Berechnung und Analyse von Bildungsrenditen. Sie untersucht verschiedene methodische Ansätze, vergleicht internationale Ergebnisse und konzentriert sich speziell auf die Analyse deutscher Bildungsrenditen anhand von ALLBUS-Daten.
Welche Methoden zur Berechnung von Bildungsrenditen werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt das Mincer-Becker-Modell, beginnend mit dem "Schooling Model", das den Zusammenhang zwischen Bildung und Einkommen darstellt. Es erweitert dieses Modell um "Post-School Investments" (wie Weiterbildungen) und diskutiert kritisch die Probleme und Grenzen des Modells.
Wie werden internationale Vergleiche von Bildungsrenditen behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf eine bestehende Studie (Lorenz und Wagner 1993) zum internationalen Vergleich von Bildungserträgen. Sie analysiert, wie sich Bildungsinvestitionen in verschiedenen Ländern auf das Einkommen auswirken und welche Unterschiede in den Renditen bestehen. Die Bedeutung internationaler Vergleiche im Kontext der Globalisierung wird hervorgehoben.
Wie werden deutsche Bildungsrenditen analysiert?
Die Analyse deutscher Bildungsrenditen basiert auf ALLBUS-Daten. Die Arbeit beschreibt die praktische Berechnung der Renditen anhand dieser Daten, präsentiert die Ergebnisse und diskutiert diese kritisch im Hinblick auf spezifische sozioökonomische Einflussfaktoren in Deutschland.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Wichtige Konzepte sind: Bildungsrenditen, Humankapitaltheorie, Schooling Model, Post-School Investments, Mincer-Becker-Modell, ALLBUS-Daten, internationale Vergleiche, Bildungsökonomie, ökonomischer Wert von Bildung, Produktivität und Einkommen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Berechnung von Bildungsrenditen, ein Kapitel zum internationalen Vergleich, ein Kapitel zur Analyse deutscher Bildungsrenditen und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird detailliert zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Berechnung von Bildungsrenditen zu erläutern, internationale Bildungserträge zu betrachten und detailliert deutsche Bildungserträge zu analysieren. Sie verwendet die Humankapitaltheorie als theoretischen Rahmen.
Welche Probleme und Grenzen des Konzepts der Bildungsrenditen werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Aussagekraft der Berechnungen und die Limitationen der Modellierung kritisch. Die Probleme und Grenzen des bildungsökonomischen Konzeptes werden explizit diskutiert.
- Quote paper
- David Peters (Author), 2005, Deutsche Bildungsrenditen im internationalen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/117790