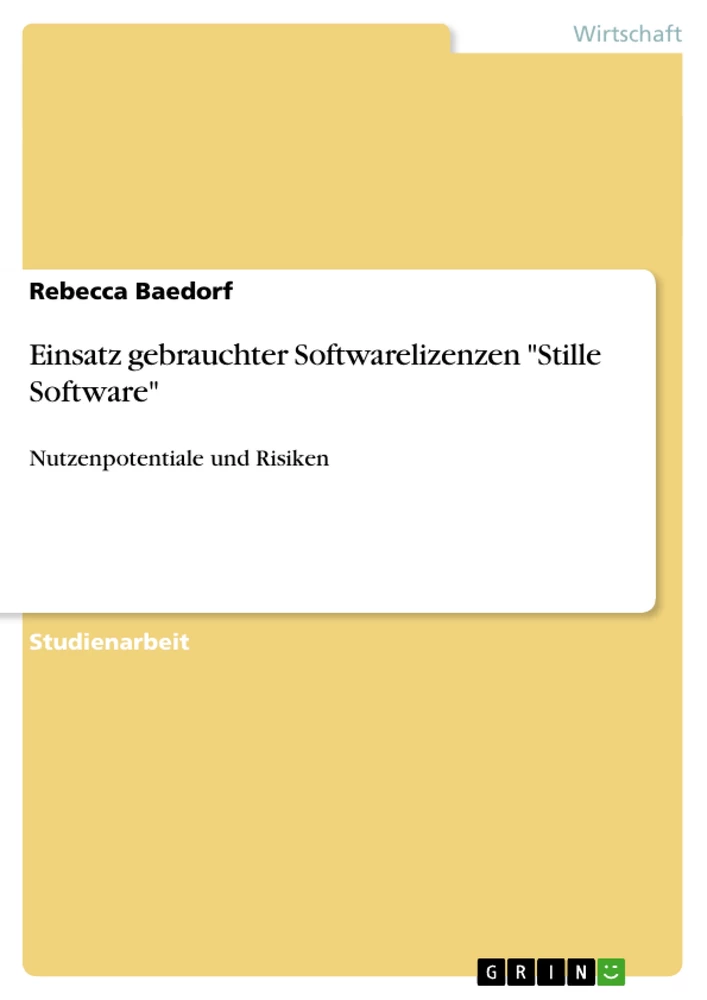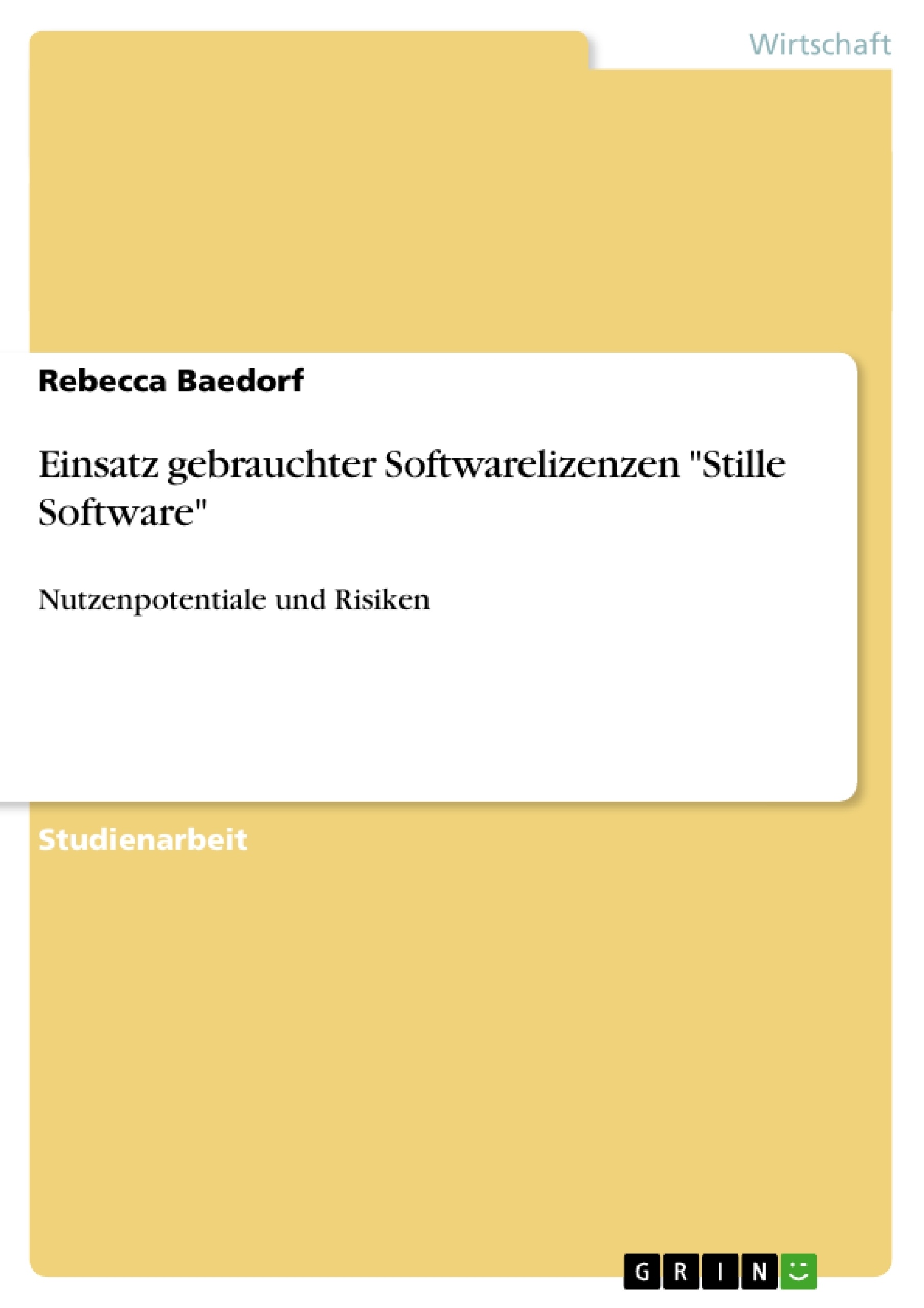Kaum ein Unternehmen kommt heutzutage ohne den Einsatz von Software aus. Dabei handelt es sich in erster Linie um den Einsatz von Software-Lizenzen. Ein Unternehmen erwirbt folglich nicht die Software als solche, sondern lediglich die Nutzungsrechte an dieser (vgl. Splittgerber/Schröder, 2005, S. 6) – beispielsweise durch den Kauf eines Programms auf einer CD oder durch das Herunterladen aus dem Internet. Software kommt in den verschiedensten Bereichen eines Unternehmens zum Einsatz: Sei es die tägliche Nutzung von Textverarbeitungssoftware, die Notwendigkeit eines Betriebssystems oder die softwaregesteuerte Lagerverwaltung. Ein Unternehmen benötigt jedoch in der Regel nicht nur eine Lizenz pro Software, sondern eine Lizenz für jeden Rechner, an dem die Software eingesetzt wird. Dementsprechend summieren sich die Kosten, die für die Nutzung einer Software entstehen.
Eine Möglichkeit zur Kostensenkung ist der Einsatz gebrauchter Software-Lizenzen. Seit rund sieben Jahren gibt es Händler, die ausschließlich gebrauchte Software-Lizenzen vertreiben, das heißt Lizenzen, die nach dem Verkauf des Herstellers an einen Kunden von diesem genutzt wurden und anschließend weiterveräußert werden. Die Händler kaufen Lizenzen in großen Mengen aus Konkursmassen oder von Unternehmen, bei denen ungenutzte Software-Lizenzen existieren – beispielsweise aufgrund von Personalentlassungen oder Firmenumstrukturierungen (vgl. Eisele, F., 01.10.2007, http://www.it-business.de)
Software unterliegt jedoch dem Urheberrecht, womit es sich um ein geschütztes Werk handelt. Laut Gesetzgeber hat damit prinzipiell der Urheber, also der Softwarehersteller oder der Programmierer, das Recht, die Verbreitung seiner Werke zu kontrollieren. Damit stellt sich die Frage, ob ein Softwarenutzer rechtlich seine Software-lizenz veräußern darf, beziehungsweise ob der Einsatz gebrauchter Lizenzen legitim ist (vgl. Reppesgaard, L. in Wirtschaftswoche, 2007, S. 110).
Diese Hausarbeit soll dem Leser einen Überblick über die Entwicklung und die rechtliche Situation des Gebraucht-Softwaremarktes geben. Darüber hinaus werden die Nutzenpotentiale und Risiken des Einsatzes und des Handels gebrauchter Software-Lizenzen erläutert und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Handel mit „Stiller Software“ und seine rechtliche Grundlage
2.1 Von der genutzten Software-Lizenz zur „Stillen Software“
2.2 Entwicklung des Gebrauchtsoftwaremarktes
2.3 Der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrechtsgesetz
3 Gerichtliche Entscheidungen
3.1 Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2000
3.2 Klage Oracle gegen Usedsoft
3.3 Klage eines Fachhändlers gegen Usedsoft
4 Aspekte des Einsatzes „Stiller Software“
4.1 Risiken für Käufer und Verkäufer „Stiller Software“
4.2 Nutzenpotentiale durch gebrauchte Software für Käufer und Verkäufer
4.3 Bedeutung des Handels mit „stiller Software“ für Softwarehersteller
5 Zusammenfassung der Betrachtungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Umfrageergebnis "Gebrauchte Software Lizenzen"
Quelle: www.experton-group.de (20.07.2007) 11
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Kaum ein Unternehmen kommt heutzutage ohne den Einsatz von Software aus. Dabei handelt es sich in erster Linie um den Einsatz von Software-Lizenzen. Ein Unternehmen erwirbt folglich nicht die Software als solche, sondern lediglich die Nutzungsrechte an dieser (vgl. Splittgerber/Schröder, 2005, S. 6) – beispielsweise durch den Kauf eines Programms auf einer CD oder durch das Herunterladen aus dem Internet. Software kommt in den verschiedensten Bereichen eines Unternehmens zum Einsatz: Sei es die tägliche Nutzung von Textverarbeitungssoftware, die Notwendigkeit eines Betriebssystems oder die softwaregesteuerte Lagerverwaltung. Ein Unternehmen benötigt jedoch in der Regel nicht nur eine Lizenz pro Software, sondern eine Lizenz für jeden Rechner, an dem die Software eingesetzt wird. Dementsprechend summieren sich die Kosten, die für die Nutzung einer Software entstehen.
Eine Möglichkeit zur Kostensenkung ist der Einsatz gebrauchter Software-Lizenzen. Seit rund sieben Jahren gibt es Händler, die ausschließlich gebrauchte Software-Lizenzen vertreiben, das heißt Lizenzen, die nach dem Verkauf des Herstellers an einen Kunden von diesem genutzt wurden und anschließend weiterveräußert werden. Die Händler kaufen Lizenzen in großen Mengen aus Konkursmassen oder von Unternehmen, bei denen ungenutzte Software-Lizenzen existieren – beispielsweise aufgrund von Personalentlassungen oder Firmenumstrukturierungen (vgl. Eisele, F., 01.10.2007, http://www.it-business.de)
Software unterliegt jedoch dem Urheberrecht, womit es sich um ein geschütztes Werk handelt. Laut Gesetzgeber hat damit prinzipiell der Urheber, also der Softwarehersteller oder der Programmierer, das Recht, die Verbreitung seiner Werke zu kontrollieren. Damit stellt sich die Frage, ob ein Softwarenutzer rechtlich seine Softwarelizenz veräußern darf, beziehungsweise ob der Einsatz gebrauchter Lizenzen legitim ist (vgl. Reppesgaard, L. in Wirtschaftswoche, 2007, S. 110).
Diese Hausarbeit soll dem Leser einen Überblick über die Entwicklung und die rechtliche Situation des Gebraucht-Softwaremarktes geben. Darüber hinaus werden die Nutzenpotentiale und Risiken des Einsatzes und des Handels gebrauchter Software-Lizenzen erläutert und analysiert.
2 Handel mit „Stiller Software“ und seine rechtliche Grundlage
2.1 Von der genutzten Software-Lizenz zur „Stillen Software“
Im Jahr 2004 existierten in deutschen Unternehmen einer Berechnung der Meta Group zufolge ungenutzte Softwarelizenzen im Wert von 250 Mio. Euro. 38% der Softwareausgaben weltweit entfielen auf Software, die nicht genutzt wird (vgl. Sohn, G., 28.09.2007, http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=040827005). Der Geschäftsführer des Aachener Softwarehändlers Susensoftware GmbH, Axel Susen, bezeichnet diese Lizenzen als „Stille Software“, womit Softwarelizenzen gemeint sind, die nachdem sie in der Bilanz abgeschrieben worden sind nicht mehr genutzt werden (vgl. o. V., 28.09.2007, http://www.susensoftware.de/hintergrund/was-ist-stille-software.php). Die Bezeichnung „Stille Software“ ist abgeleitet aus dem Begriff „Stille Reserven“, beziehungsweise „Stille Rücklagen“. Damit werden Teile des Eigenkapitals eines Unternehmens bezeichnet, die nicht aus der Bilanz ersichtlich sind (vgl. Jung, 2004, S.1021).
Die Gründe für die hohe Anzahl an nicht benötigten Softwarelizenzen sind zahlreich. Dazu zählen Insolvenzen von Unternehmen, Mitarbeiterentlassungen, Umstrukturierungen, abgeschlossene Firmenprojekte oder Systemumstellungen. Durch den Verkauf dieser Lizenzen wird „Stille Software“ wieder zu liquiden Mitteln.
2.2 Entwicklung des Gebrauchtsoftwaremarktes
Nicht nur die Unternehmen, die ungenutzte Software-Lizenzen besitzen, können Kapital aus „Stiller Software“ schlagen. Einige Softwarehändler haben sich auf den Handel mit gebrauchten Software-Lizenzen spezialisiert. Zu den bekanntesten Händlern gehören die usedSoft AG in München, die Susensoftware GmbH in Aachen, 2nd Soft in Aachen, U-S-C in München und die Preo Software AG in Hamburg. Analysten der Experton Group schätzen das Volumen des Gebrauchtsoftwaremarktes auf ca. 30 Mio. Euro, was ungefähr 2,5% des gesamten Softwaremarktes entspricht (vgl. o. V., 28.09.2007, http://www.experton-group.de).
Axel Oppermann von der Experton Group kommt zu dem Ergebnis, dass der Markt für gebrauchte Software ein großes Potential aufweist, derzeit jedoch noch recht umsatzschwach ist. Weiterhin beschreibt er, dass sich immer mehr Unternehmen über gebrauchte Software informieren. Laut einer Analyse, in der Nutzer gebrauchter Lizenzen befragt wurden, steht für die Unternehmen in erster Hinsicht die Möglichkeit der Kostenersparnis im Vordergrund (vgl. a. a. O.), denn gebrauchte Software kostet lediglich einen Bruchteil der unter Umständen sehr teuren Neuware (vgl. Pauly, D. A./Störing, M., in c’t, 2007, S. 152).
Der Berliner Volksbank gelang es zum Beispiel, 750.000 Euro durch gebrauchte Microsoft Software zu sparen. Weitere Unternehmen die zu den Nutzern „Stiller Software“ zählen sind unter anderem das Pharmaunternehmen Klosterfrau, der Heinrich-Bauer-Verlag oder der EDEKA-Konzern. Insgesamt soll sich der Umsatz mit gebrauchter Software in den nächsten Jahren, von den erwähnten 30 Mio. Euro auf 400 Mio. Euro steigern (vgl. Höfninghoff, T., 26.09.2007, http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,446409,00.html).
Was derzeit allerdings Unsicherheit in der Branche verbreitet ist die bislang noch umstrittene Rechtslage.
2.3 Der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrechtsgesetz
Hinter einer funktionierenden Software stehen die Entwickler und Programmierer, die durch ihre geistigen Fähigkeiten und Kreativität ein Computerprogramm erschaffen. Dadurch zählt Software, ebenso wie Gemälde, Musikstücke oder literarischen Texten zu den geschützten Werken und unterliegt damit bis siebzig Jahre nach dem Tod des Urhebers dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, auch Urheberrechtsgesetz genannt (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG). Aufgrund dieser Tatsache hat allein der Rechtsinhaber, also der Urheber, über Verbreitung und Vervielfältigung seines Werkes zu bestimmen (vgl. §§ 69c Nr. 1 S. 1, Nr. 3 S. 1 UrhG). Um Kunden die Nutzung der Software zu ermöglichen wird diesen vom Urheber ein Nutzungsrecht, beziehungsweise eine Lizenz, eingeräumt, da das Urheberrecht laut Gesetz nicht übertragbar ist. Der Urheber ist damit gleichzeitig der Lizenzgeber, die Softwarenutzer dementsprechend die Lizenznehmer (vgl. Splittgerber, A./Schröder G., 2005, S. 9). Somit wird üblicherweise nicht die eigentliche Software, bestehend aus Quellcode, Dokumentationen und weiteren Programmierschritten veräußert, sondern lediglich die Software-Lizenz.
Wie bei einem Auto, dass nach einer gewissen Zeit der Nutzung vom Käufer beispielsweise an einen Händler weiterverkauft werden kann, kommt es auch - wie bereits erwähnt - bei Computerprogrammen vor, dass der Lizenznehmer seine Software-Lizenz nicht weiter benötigt und veräußern möchte. Da dies scheinbar durch das Urheberrechtsgesetz nicht möglich ist und Computerprogramme somit nicht genügend verkehrsfähig wären, hat der Gesetzgeber durch den so genannten Erschöpfungsgrundsatz vorgebeugt: “Wird ein Vervielfältigungsstück eines Computerprogramms mit Zustimmung des Rechtsinhabers im Gebiet der Europäischen Gemeinschaften oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht, so erschöpft sich das Verbreitungsrecht in Bezug auf dieses Vervielfältigungsstück mit Ausnahme des Vermietrechts“ (§ 69c Nr. 3. S. 2 UrhG ). Dies bedeutet, dass die weitere Verbreitung einer Software, die vom Lizenzgeber an einen Händler oder Kunden verkauft wurde, vom Urheber nicht mehr kontrolliert werden kann. Der Erschöpfungsgrundsatz bezieht sich allerdings wie im Gesetz erwähnt lediglich auf das Verbreitungsrecht an der Software und nicht auf das Vervielfältigungsrecht. Dadurch muss der Nutzer der Software, der diese verkaufen möchte, gewährleisten, keine Kopie des Programms zu besitzen - sei es als Kopie auf einem Datenträger oder als Installation auf dem PC.
3 Gerichtliche Entscheidungen
3.1 Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2000
Der Erschöpfungsgrundsatz ist die Grundlage für ein Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2000. Der Softwarehersteller Microsoft klagte gegen einen Berliner Hard- und Software-Händler, der OEM-Software (Original Equipment Manufacturer), die er zuvor von einem Zwischenhändler erwarb, ohne zugehörigen PC verkaufte. OEM-Software wird als Paket zusammen mit Hardware, zum Beispiel einem PC, veräußert. Der Softwarehersteller schließt dazu Verträge mit den Hardwareherstellern und Zwischenhändlern ab, mit der Auflage, dass die Software nicht isoliert verkauft werden darf. Der Paketpreis ist schließlich günstiger, als die Summe der Einzelpreise. Darüber hinaus kennzeichnet Microsoft seine OEM-Produkte mit einem Hinweis-Etikett und weist so auf die besonderen Vertragsbedingungen hin (BGH Urteil vom 06.07.2000, I ZR 244/97).
Das Berliner Landgericht gab der Klage zunächst statt, der Beklagte Händler ging in Revision und der Bundesgerichtshof entschied letztendlich, die Klage Microsofts abzuweisen. Das Gericht bezog sich bei der Entscheidung auf den erwähnten Erschöpfungsgrundsatz, mit der Begründung, dass das Verbreitungsrecht des Urhebers mit dem zugestimmten Verkauf an einen Zwischenhändler erschöpft sei. Dies schließe auch den Verkauf von OEM-Software mit ein, wenn diese, wie im vorliegenden Fall, einmal veräußert wurde (vgl. a. a. O.).
[...]
- Quote paper
- Rebecca Baedorf (Author), 2007, Einsatz gebrauchter Softwarelizenzen "Stille Software", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/117707