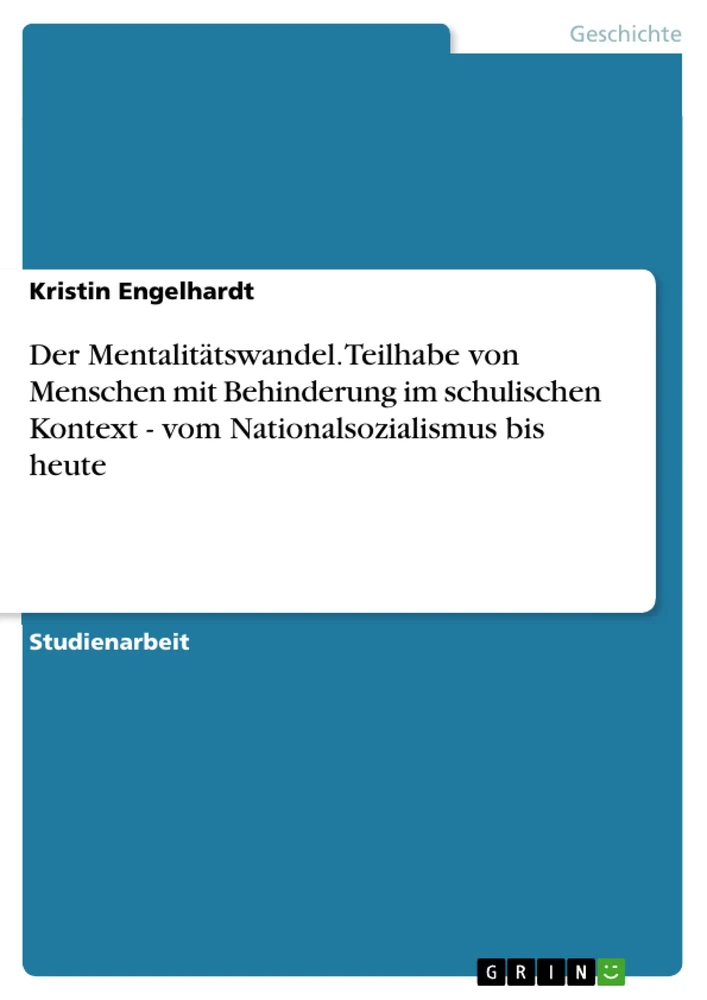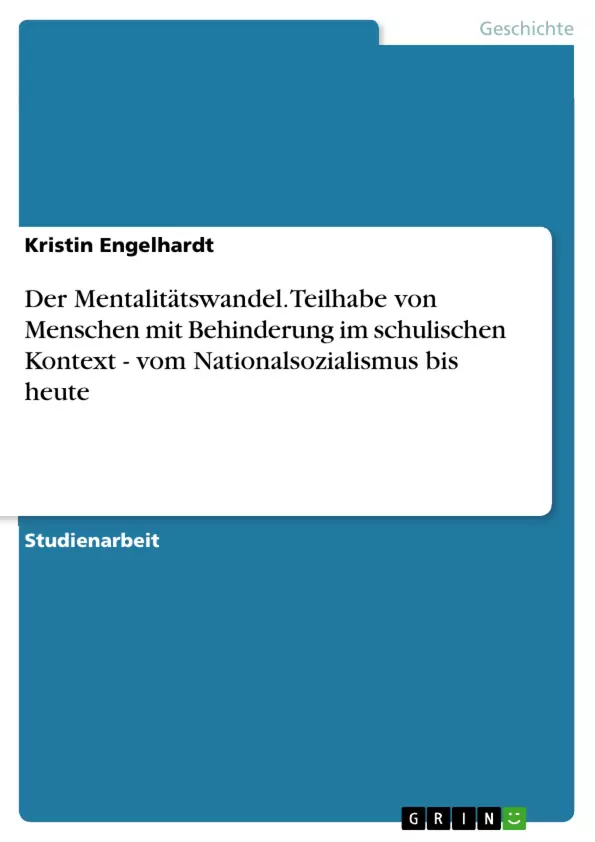In der Arbeit soll anhand der Evolution die Fragen beantwortet werden, wie die ersten Forderungen nach Gleichberechtigung entstanden sind und welche Maßnahmen nötig waren, um die Teilhabe behinderter Menschen und das gemeinsame Lernen zu ermöglichen. Ausgehend von der NS-Politik ist die Veränderung und Weiterentwicklung der zu dieser Zeit bestehenden Denk- oder Verhaltensmuster, ein weiterer Gegenstand dieser Hausarbeit. Für ein besseres Verständnis der Ausgangslage, wird in Kapitel zwei das Menschenbild Behinderter und die Höhepunkte der Aussonderung anhand der Euthanasieverbrechen mit anschließendem Übergang zu ersten Einforderungen gesellschaftlicher Teilhabe aufgezeigt. Das dritte Kapitel dient zur Einleitung des sich langsam anbahnenden Blickwechsels bezüglich der ersten Forderungen nach gesellschaftlichen Einschluss beeinträchtigter Menschen. Den zentralen Passus übernimmt in Kapitel vier der Entwicklungsverlauf der schulischen Integration. Die Teilhabe der heutigen Zeit wird in Punkt fünf erläutern und Selbstwahrnehmungen beschrieben. Die Beispielerfahrungen bieten gleichzeitig einen Anreiz, um über den Wechsel der Denk- und Verhaltensmuster zu diskutieren und einen Mentalitätswechsel anhand weiterer Erfahrungen des Lesers zu reflektieren. Die Auseinandersetzung mit der UN-Behindertenrechtskonventionen nimmt dabei einen separaten Unterpunkt ein, da sie die gesetzliche Verankerung des gemein-samen Lernens darstellt. In einem anschließenden Fazit werden theoretische Überlegungen und Ergebnisse zusammengeführt und liefern Antworten auf die oben aufgeführten Fragestellungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Höhepunkt einer Exklusionspolitik - Behinderung im Nationalsozialismus
- Das Menschenbild und der Wert Behinderter zur Zeit des Nationalsozialismus.
- Die Euthanasie von Menschen mit Behinderung.
- Kindereuthanasie
- Erwachseneneuthanasie Aktion T4
- Sonderbehandlung 14f13 und Aktion Brandt.
- Rechtliche Grundlagen der Rassenhygiene.
- Erste Rufe nach Teilhabe
- Eine Zusammenfassung über die Entwicklung der Integrationspädagogik nach 1945
- Teilhabe heute
- UN-Behindertenrechtskonvention und weitere Zielsetzungen
- Integration als rechtliche Grundlage und moralische Bereitschaft.
- Eigener Standpunkt aus heutiger Sicht.
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung im schulischen Kontext in Deutschland, insbesondere den Wandel vom Nationalsozialismus bis zur heutigen Zeit. Sie beleuchtet die Entstehung der ersten Forderungen nach Gleichberechtigung und die notwendigen Maßnahmen, um die Teilhabe behinderter Menschen und das gemeinsame Lernen zu ermöglichen.
- Das Menschenbild von Menschen mit Behinderung im Nationalsozialismus und die Euthanasie.
- Die Entstehung der ersten Forderungen nach gesellschaftlichem Einschluss.
- Der Entwicklungsverlauf der schulischen Integration.
- Die heutige Situation der Teilhabe und die UN-Behindertenrechtskonvention.
- Der Mentalitätswandel und die Veränderung von Denk- und Verhaltensmustern.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Teilhabe von Menschen mit Behinderung in den historischen Kontext und beschreibt den Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet die Entwicklung von der Exklusionspolitik des Nationalsozialismus zur heutigen Inklusion.
- Der Höhepunkt einer Exklusionspolitik – Behinderung im Nationalsozialismus: Dieses Kapitel beleuchtet das menschenverachtende Menschenbild des Nationalsozialismus gegenüber Menschen mit Behinderung und setzt die Euthanasie in den Zusammenhang mit eugenischen und sozialdarwinistischen Theorien. Es beschreibt die systematische Tötung von Menschen mit Behinderung im Rahmen der „Aktion T4“ und anderer Maßnahmen, die die Rechtlichen Grundlagen der Rassenhygiene erörtern.
- Erste Rufe nach Teilhabe: Dieses Kapitel untersucht die ersten Forderungen nach Teilhabe und die Anfänge der Integrationsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Eine Zusammenfassung über die Entwicklung der Integrationspädagogik nach 1945: Dieses Kapitel stellt die Entwicklung der Integrationspädagogik von den ersten Ansätzen bis zur Einführung der Inklusion dar. Es behandelt die verschiedenen Phasen der Integration, die Herausforderungen und Erfolge dieser Entwicklung.
- Teilhabe heute: Dieses Kapitel behandelt die heutige Situation der Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Es betrachtet die UN-Behindertenrechtskonvention und die Integration als rechtliche Grundlage und moralische Bereitschaft. Außerdem wird ein persönlicher Standpunkt aus heutiger Sicht erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themenbereiche Inklusion, Integration, Behinderung, Nationalsozialismus, Euthanasie, Rassenhygiene, Menschenbild, Teilhabe, UN-Behindertenrechtskonvention, Mentalitätswandel.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurden Menschen mit Behinderung im Nationalsozialismus behandelt?
Sie wurden systematisch ausgegrenzt und im Rahmen der "Euthanasie"-Programme (z. B. Aktion T4) als "lebensunwert" ermordet.
Wann entstanden die ersten Forderungen nach schulischer Integration?
Erste Bestrebungen und "Rufe nach Teilhabe" entwickelten sich verstärkt nach 1945 als Reaktion auf die Verbrechen der NS-Zeit und führten zur Entstehung der Integrationspädagogik.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration bedeutet das Hineinnehmen von Menschen in ein bestehendes System. Inklusion zielt darauf ab, das System so zu verändern, dass Vielfalt von vornherein die Norm ist.
Welche Bedeutung hat die UN-Behindertenrechtskonvention?
Sie ist die völkerrechtliche Grundlage, die das Recht auf gemeinsame Bildung und volle gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung gesetzlich verankert.
Was versteht man unter dem "Mentalitätswandel" in diesem Kontext?
Es ist die Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung: Weg von der Defizitorientierung und Aussonderung hin zur Anerkennung von Behinderung als Teil menschlicher Vielfalt.
- Arbeit zitieren
- Kristin Engelhardt (Autor:in), 2021, Der Mentalitätswandel. Teilhabe von Menschen mit Behinderung im schulischen Kontext - vom Nationalsozialismus bis heute, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1175771