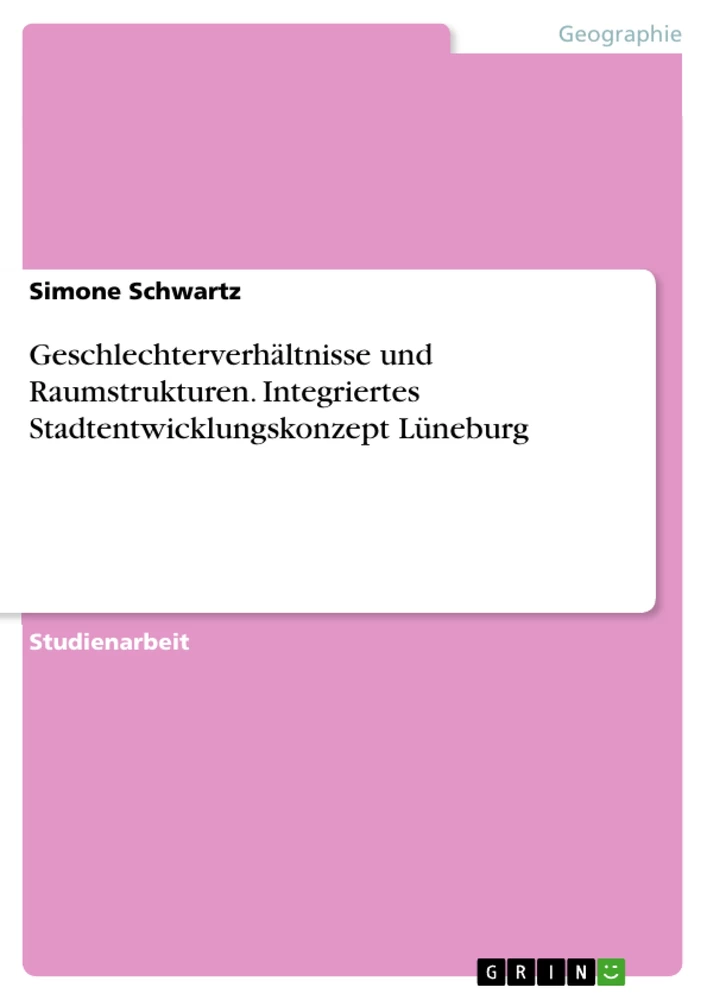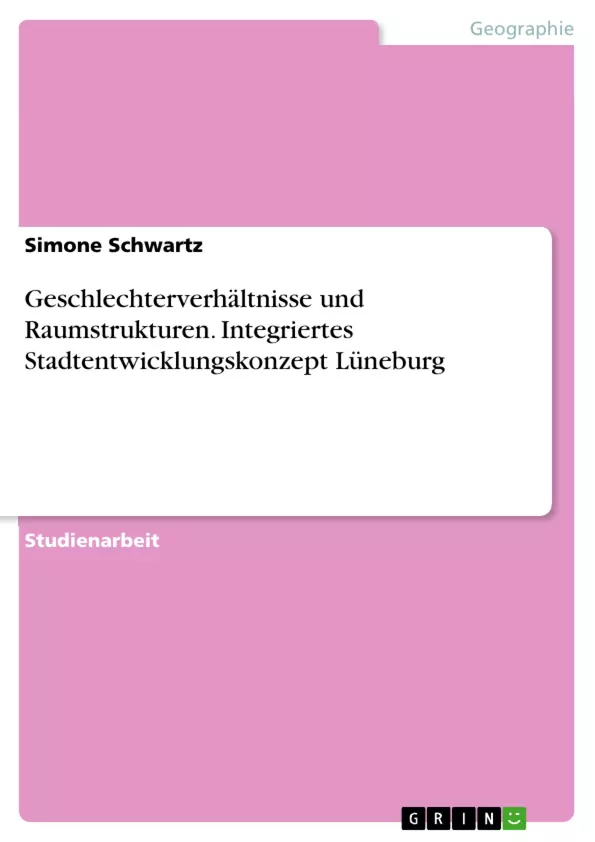Diese Hausarbeit handelt von Geschlechterverhältnissen und Raumstrukturen am Beispiel eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts in Lüneburg.
2017 wurden Erfahrungen, Stand und Perspektiven des Qualitätsmerkmal Gender in der Stadtentwicklung und Stadtplanung reflektiert, mit folgendem Ergebnis: Gender sei nicht in allen Dimensionen angekommen. Neue Probleme würden mit neuen Fragen einhergehen, Machtfragen stünden in Konkurrenz mit Fachfragen, Wachstumsdruck und Effizienzsteigerung von sozialen und räumlichen Qualitäten verschlechtern die Aufnahme in den Mainstream. Dennoch sind viele Städte wie beispielsweise Berlin, München und Wien Vorbilder hinsichtlich gerechter Berücksichtigung von Lebensidealen und Bedürfnissen von Frauen und Mädchen an den Raum.
Die diesjährig durchgeführten Grundlagenermittlungen hinsichtlich einer Stadterneuerung resultieren aus dem im Herbst 2017 erfolgten Beschluss des Stadtrats in Lüneburg: Um vor den demografischen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein, bräuchte die Hansestadt neue Antworten im Bereich Stadt- und Raumplanung – Antworten, die mittels Bürger:Innenbeteiligungen und moderierten Öffentlichkeitsarbeiten gemeinsam gefunden werden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Merkmale einer geschlechtergerechten Stadtplanung
- Zukunftsstadt 2030+
- Tendenzen in Richtung einer geschlechtergerechteren Stadtplanung
- Zukunftsstadt 2030+
- Stadtentwicklungskonzept Braunschweig
- Tendenzen in Richtung einer weiterhin geschlechterungerechten Stadtplanung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht, inwiefern ein modernisiertes Lüneburg auch ein geschlechtergerechtes Lüneburg bedeutet. Sie analysiert die aktuelle Stadtentwicklungsplanung Lüneburgs im Kontext des Projekts „Zukunftsstadt Lüneburg 2030+“ und des Stadtentwicklungskonzepts Braunschweig, um Tendenzen hinsichtlich einer geschlechtergerechteren Stadtplanung zu erkennen.
- Die Merkmale einer geschlechtergerechten Stadtplanung
- Die Umsetzung von geschlechtergerechten Aspekten im Projekt „Zukunftsstadt 2030+“
- Die Berücksichtigung von Geschlechtergerechtigkeit im Stadtentwicklungskonzept Braunschweig
- Die Tendenzen hin zu einer geschlechtergerechteren Stadtplanung
- Die Tendenzen hin zu einer weiterhin geschlechterungerechten Stadtplanung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtplanung und skizziert die Forschungsfrage. Es wird erläutert, warum das Stadtentwicklungskonzept Braunschweig als Orientierungshilfe für Lüneburg dient. Im ersten Kapitel werden die Merkmale einer geschlechtergerechten Stadtplanung aus der feministischen Forschung vorgestellt. Die Analyse des Projekts „Zukunftsstadt 2030+“ erfolgt im zweiten Kapitel.
Schlüsselwörter
Geschlechtergerechtigkeit, Stadtplanung, Stadtentwicklungskonzept, Lüneburg, Zukunftsstadt 2030+, Stadtentwicklungskonzept Braunschweig, feministische Forschung, öffentlicher Raum, Fußwegenetz, Verkehrsanbindung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter geschlechtergerechter Stadtplanung?
Es handelt sich um eine Planung, die die unterschiedlichen Lebensrealitäten und Bedürfnisse von Frauen, Männern und Mädchen im öffentlichen Raum (z. B. Sicherheit, Fußwegenetze) berücksichtigt.
Was ist das Projekt „Zukunftsstadt Lüneburg 2030+“?
Ein integriertes Stadtentwicklungskonzept, das Antworten auf demografische, wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen durch Bürgerbeteiligung finden will.
Warum wird Braunschweig als Vergleich für Lüneburg herangezogen?
Das Stadtentwicklungskonzept Braunschweig dient als Orientierungshilfe, um Tendenzen einer geschlechtergerechten Planung im Vergleich zu Lüneburg zu analysieren.
Welche Rolle spielt die feministische Forschung in dieser Arbeit?
Sie liefert die theoretischen Merkmale für eine gerechte Berücksichtigung von Lebensidealen in der Stadtentwicklung.
Ist Lüneburg bereits ein Vorbild für geschlechtergerechte Planung?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und stellt fest, dass Gender-Aspekte oft noch nicht in allen Dimensionen der Planung angekommen sind.
- Arbeit zitieren
- Simone Schwartz (Autor:in), 2019, Geschlechterverhältnisse und Raumstrukturen. Integriertes Stadtentwicklungskonzept Lüneburg, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1175562